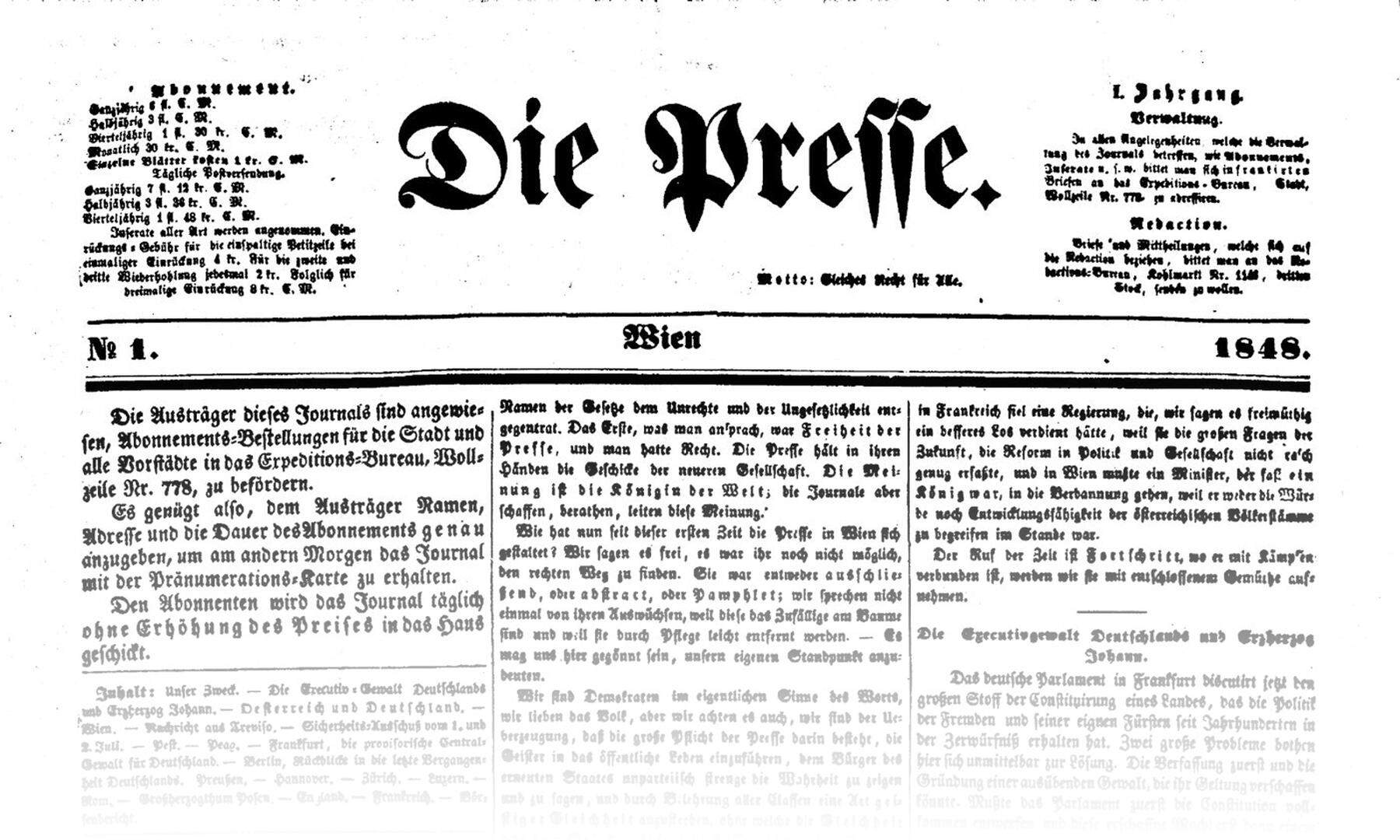
Ein Aufruf von Sektionsrat Ing. Dr. Klimesch.
Neue Freie Presse am 8. September 1934
Als mir im Vorjahr die Organisation der Brennholzpropagandaausstellung auf der Wiener Herbstmesse übertragen wurde, hieß es, Neuland betreten. Ein Jahr ist vergangen. Im Frühjahr 1934 war das Holz schon in den Brennstoffverordnungen gleichberechtigter Partner der heimischen Braunkohle. Und die letzten Wochen haben die große Aktion des Regierungszuschusses von 300.000 G. zur Förderung des Neu- und Umbaues von Holzheizungsstätten gebracht.
Bei Umbauten oder Neuanschaffungen von Holzheizungsöfen werden den Verbrauchern aus den erwähnten Mitteln Zuschüsse bis zu 30 Prozent der Kosten gewährt. Diese Aktion ist der Initiative von Gewerbe und Industrie zu danken, die aber auch sonst nicht müßig gewesen sind: Der Reichsverband der Hafner Oesterreichs hat die Bevölkerung über die Vorzüge des mit Holz geheizten Kachelofens aufgeklärt und Werbung und Aufklärung auch in die Reihen seiner eigenen Fachgenossen getragen.
Durch eine sehr lehrreiche, eingehende Anweisung zum Bau von Kachelöfen für Holzheizung wird es auch den Hafnern in der Provinz ermöglicht, die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiete des Kachelofenbaues zu verwerten, so daß einwandfrei konstruierte Kachelöfen für Holzheizung gegenwärtig eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind.
Der glücklichste Tag eines Ehemannes
Im Juni oder Juli, wenn der Mann mit den Motten und dem Sommerstaub alleine ist, dann steht die Häuslichkeit still. Danach heißt es: Krieg!
Neue Freie Presse am 7. September 1924
Ein Ehemann schreibt uns: Die bekannten „zwei glücklichen Tage“, von Blumenthal und Kadelburg, nämlich der Tag, an dem man eine Villa erwirbt, und der andere, an dem man sie wieder los wird, spielen auch im Kalender der Häuslichkeit und des Familienlebens eine große Rolle. Der eine glückliche Tag ist der Juni- oder Julitag, an dem der Wirtschaftsbetrieb stillgelegt wird, die Familie aufs Land geht und das Oberhaupt unbetreut und unbedient mit den Motten und dem Sommerstaub endlich allein ist.
Wesentlich glücklicher aber ist doch der Tag, an dem der Häuslichkeitsbetrieb wieder aufgenommen wird, was freilich nicht ganz reibungslos vor sich geht: bei uns wird sogar aus diesem Anlaß erschütternd viel gerieben, gebürstet und geputzt. Die gestern noch idyllisch staubige und traulich vernachlässigte Wohnung wird plötzlich zum Tummelplatz wilder Bedienerinnenleiden. Unter der Devise „gründlichräumen“ ereignen sich alle Greuel einer unerbittlichen Kriegsführung. Zum Zeichen der Feindseligkeit haben sich die diversen weiblichen Wesen den Kopf mit Tüchern eingebunden, andere Tücher tragen sie in Händen, an die Schürze angesteckt oder sie drapieren damit die große Sesselleiter, die derart den beängstigenden Eindruck eines Sturmbocks macht, wie er in alten Zeiten zur Einnahme von Festungen diente.
Ein Zimmer nach dein andern wird auch mühelos von den vereinigten Bedienerinnen und Hausgehilfinnen erobert, nur das Arbeitszimmer ist „noch in meinem Besitz“, bis ich, von allen Seiten zerniert, vor den enervierenden Aufräumungsgeräuschen die Flucht ergreife. Aber wenn dann die Schlacht geschlagen und das letzte Zimmer fertig ist, sogar das Vorzimmer samt Nebenräumen, wenn die Vorhänge angebracht und die Teppiche aufelegt sind, dann kommt es einem mit einem Male zum Bewußtsein, was für eine schöne, angenehme Wohnung man hat, und daß es eigentlich kein besseres Vergnügen gibt als Wohnen.
Man geht durch die Räume wie durch eine Ausstellung am Tag vor der Eröffnung für das große Publikum, und alle die wohlbekannten Dinge erscheinen einem neu und reizvoll. Das Silber im Glaskasten, das schöne Geschirr in der Kredenz, sagt ganz deutlich: „Da schau’ mich an. Hast du das nötig gehabt, den ganzen Sommer auf miserablem Gasthausgeschirr zu essen?“ Und der gemütliche Ohrenfauteuil unter der Stehlampe sagt einladend: „Komm‘ her, nimm’ Platz. Hier sitzt sich’s besser, ungestörter, als in der erstklassigsten Hotelhall.“
Der Höhepunkt dieses Firnistages ist aber das erste Nachtmahl zu Hause. Nach langen, entbehrungsreichen Erholungswochen sitzt man endlich wieder mit der Gattin allein bei Tisch, ohne Bekannte und Verehrer, freut sich der Akkuratesse, der Ordnung, der häuslichen Küche und denkt sich: Ach, wenn es doch nur immer so bliebe, wenn die Ausstellung nie für den allgemeinen Besuch eröffnet würde. Aber bevor ich diesen Wunsch noch aussprechen kann, sagt meine Gattin schon entschlossen: „Gott sei Dank, daß die Wohnung fertig ist. Übermorgen hab‘ ich meine erste Bridgepartie…“
Die erste österreichische Eisenbahn
Eigentlich ist Österreichs Eisenbahn gar nicht 100 Jahre alt – oder doch? Nun ja, je nachdem, wie man rechnet.
Neue Freie Presse am 6. September 1924
Jede alte Eisenbahn fuhr mit ihrem eigenen Witz.
Die österreichische mit dem des Kaiser Franz über die leeren Stellwagen: Wien-Brünn. Die deutsche mit denen des Königs Friedrich Wilhelm III. und seines Verkehrsministers v. Nagler. Er antwortete dem einer Bahn Berlin-Potsdam Vorschlagenden: „Dummes Zeug! Ich lasse täglich sechs Sitzposten nach Potsdam gehen, und es sitzt niemand drinnen. Wenn Sie ihr Geld absolut los werden wollen, so werfen Sie es doch gleich liebe zum Fenster hinaus, ehe Sie es zu solch unsinnigem Unternehmen hergeben!“ Und der König meinte, er könne sich keine größere Glückseligkeit vorstellen, ob man einige Stunden früher in Potsdam ankomme oder nicht.
Als schließlich vor etlichen achtzig Jahren der erste Zug aus Berlin in Potsdam einlief, ergriff der dortige Polizeidirektor Flesche, der den Zug erwartete, vor der neuartigen Erscheinung die Flucht, mit den Worten: „rette sich wer kann!“ Aerzte glaubten damals, Dampfbetrieb erzeuge Gehirnkrankheiten. Andere meinten, die Verkehrslangsamkeit sei nicht ungesund und Metternich fürchtete politische Schäden von der durch Eisenbahnen ermöglichten Freizügigkeit.
Solche Bedenken löste die allererste österreichische Eisenbahn, deren hundertster Geburtstag jetzt in Budweis gefeiert wird, nicht aus. Sie raste allerdings nicht unter Volldampf von Budweis nach Linz, sondern wurde von mehr oder weniger feurigen Rossen gezogen. Dennoch verdient sie „Eisenbahn“ genannt zu werden, denn sie bewegte sich auf eisernen Schienen. Sie fuhr auch nicht am 7. September 1824.
Von diesem Tage datiert nur die dem ehemaligen Wiener Technikprofessor Franz Anton v. Gerstner erteilte Konzession zum Bau einer zwischen Mauthausen und Budweis Donau mit Elbe verbindenden Eisenbahn. Diese 129 Kilometer lange Bahn, mit den späteren Kopfstationen Linz und Budweis, wurde am 1. August 1832 vollendet und als Pferdebahn dem Betrieb übergeben. Ihren wirklich bewegten Geburtstag wird sie somit erst in acht Jahren feiern können.
Wozu ein Telefonanschluss?
Immer mehr Privatpersonen wollen per Telefon vernetzt sein.
Neue Freie Presse am 5. September 1934
Die Zahl der Anmeldungen hat in den letzten Tagen die Zahl von 25.000 weit überschritten. Vergangenen Samstag waren es bereits 25.422. Es ist interessant, wie sich diese neuen Abonnenten verteilen. 20.828 verlangten Viertel-Gesellschaftsanschlüsse, 1996 halbe Gesellschaftsanschlüsse und 2598 Einzelanschlüsse. Daraus geht hervor, daß es meistens Privatpersonen sind die schon lang das Bedürfnis nach einem Telephon hatten, aber infolge der hohen Kosten eine Anmeldung unterließen.
Das Wiener Fernsprechnetz umfaßt nunmehr 114.500 Telephonanschlüsse, die schon im Betrieb stehen. Die gewaltige Zahl der Anmerkungen hat es trotz aller Eile und aller technischen Vorkehrungen und Neuerungen bei angespannter Arbeitsteilung nicht erlaubt, die Aufstellung der neuen Stationen zur Gänze durchzuführen. Etwa 10.000 Anschlüsse, an deren Herstellung bereits fieberhaft gearbeitet wird, sind noch durchzuführen.
Das Wunderkind
Bisher bekannt sind einseitige Begabungen für Musik oder Mathematik, für Sprachen oder andere Wissensgebiete. Giovanni aber kann alles.
Neue Freie Presse am 4. September 1934
Amerikanische Blätter melden die merkwürdige Geschichte eines Wunderkindes. Der siebenjährige Giovanni Zelenna hat ein wahrhaft abenteuerliches Leben hinter sich.
Seine Eltern, verarmte Angehörige des italienischen Mittelstandes, sind in den letzten Jahren durch die ganze Welt gereist. Der Vater, ein begabter, aber von unerhörtem Pech verfolgter Ingenieur, suchte da und dort Beschäftigung. Er fand sie in persischen Oelgruben, auf der Bagdadbahn, in Ankara, in Tokio, Charbin und San Francisco. Aber die Geschichte dieses Mannes besteht nur aus einer endlosen Zahl lückenlos sich aneinander reihender Unglücksfälle.
Jedesmal, wenn er irgendeine Arbeit gefunden hatte, stellte sich ein Zwischenfall ein, der ihn um seine Stellung brachte. Als der kleine Giovanni auf die Welt kam, befand sich das Ehepaar Zelenna in einem Vorort von San Francisco. Wenige Monate war das Kind erst alt, da brach in dem von Zelenna bewohnten Häuserblock eine Brandkatastrophe aus. Das Kind blieb durch einen unglücklichen Zufall in dem brennenden Haus zurück, wurde schließlich gerettet, aber die Eltern erfuhren nichts davon. Sechs Wochen nach dem Brandunglück besuchte Frau Zelenna mit einer Freundin ein Findelhaus und fand dort unerwarteterweise ihr Kind wieder. Das war der einzige Glücksfall seit vielen Jahren. Das Kind wuchs dann heran und entwickelte schon in einem Alter von zwei Jahren ungewöhnliche Fähigkeiten.
Es war offensichtlich frühreif, verstand es, sich selbst anzuziehen, faßt Worte der Erwachsenen mit ungewöhnlicher Intelligenz auf. Lieder, die es einmal gehört hatte, sang es ohne den geringsten Fehler. Mit vier Jahren war es bereits imstande, verhältnismäßig schwierige Rechnungen – Multiplikationen und Additionen – auszuführen, und zwar stets fehlerfrei. Vom fünften Lebensjahr an nahm die geistige Entwicklung des Kindes einen rapiden Verlauf. Der kleine Giovanni sprach um diese Zeit bereits Chinesisch – er hatte es von Chinesenjungen, mit denen er spielte, erlernt – Russisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Das Kind schien mit einem unerschöpflichen Gedächtnis gesegnet zu sein.
Es vergaß überhaupt nichts, was es hörte. Es führte die schwierigsten Rechnungen im Kopf durch, schrieb und las in allen vorhin angeführten Sprachen, zeichnete mit einer erstaunlichen Naturtreue alles Gesehene wieder, spielte Klavier, Violine und Saxophon. Alle diese Begabungen sind jedoch nicht schöpferischer Natur. Das Kind kann nur Gehörtes, Erschautes wiedergeben. Die wunderliche Begabung dieses Kindes erregt deshalb Aufsehen, weil sie keinerlei Begrenzung zu kennen scheint. Die Wunderkinder, von denen man bisher hörte, waren stets einseitig begabt, entweder in Musik oder für Mathematik, für Sprachen oder andere Wissensgebiete. Giovanni aber kann alles.
Das Wunderkind wird gegenwärtig von den Psychologen der Universität in San Francisco untersucht. Man hofft, durch eingehende Beobachtungen und Experimente Interessantes über den Ablauf der psychischen Funktionen bei Wunderkindern zu erhalten.
Der Kampf um den Brotpreis
Wie viel darf ein Laib Brot kosten?
Neue Freie Presse am 3. September 1924
Vom Kriegsschauplatz ist nichts Neues zu melden. Vor allem das nicht, was die Verbraucher mit dem bisherigen Gang der Dinge mit einer gewissen Sicherheit erwarten zu können geglaubt hatten: eine Herabsetzung des Brotpreises. Vorläufig hat sich die Ankerbrotfabrik damit begnügt, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Preisprüfungssstelle ihre, der Ankerbrotfabrik, letzte Preisfestsetzung von 8·000 Kronen für den Laib für „offenbar übermäßig“ im Sinne und in der Sprache des Preistreibereigesetzes befunden hat.
Der von seinem Erholungsurlaub nach Wien zurückgekehrte Generaldirektor des Unternehmens hat gestern einen Informationsbesuch bei der Wirtschaftspolizei gemacht. Diese dagegen hat sich jetzt darauf beschränkt, der Oeffentlichkeit nur Kenntnis von ihren Erhebungen festgestellt .Für die Oeffentlichkeit, namentlich für die Arbeiterschaft, wäre es gewiß von Interesse, zu erfahren, ob auch die Hammerbrotwerke von ihren Abnehmern einen offenbar übermäßigen Preis verlangen.
Es ist überhaupt manches unklar in dem bisherigen Gang der von der Regierung mit einem so großen Nachdruck angekündigten Untersuchung in der Brotpreisfrage.
Das verarmte Publikum des Burgtheaters
Trotz aller bisher aufgewendeten Mühen hat sich die Kluft, die zwischen dem Burgtheater und seinem ehemaligen Stammpublikum gähnt, keineswegs geschlossen.
Neue Freie Presse am 2. September 1924
Das Wort stammt vom Direktor des Burgtheaters, der heute einiges über seine Absichten für die kommende Saison mitgeteilt hat. Es sind ungemein gute Vorsätze, und keinen Augenblick soll etwa geargwöhnt werden, daß mit ihnen der Weg in die Hölle gepflastert ist, in das Inferno der ausschließlichen Rücksichtnahme auf den Theaterkassier und dessen entscheidende Rapporte. „Und die Kinder, sie hören es gern …“ Zum Schlusse seiner Ausführungen sprach Direktor Herterich von dem verarmten Publikum des Burgtheaters, womit augenscheinlich alle jene gemeint sind, denen so oft und aus so maßgebendem Munde versichert worden ist, daß das Burgtheater ohne sie überhaupt nicht denkbar sei, daß der Burgtheaterstil sich aus der Wechselwirkung zwischen den großen Künstlern des Hauses und dem verständnisvollsten, dem feinfühligsten Publikum herausgebildet habe, während sie bereits seit geraumer Zeit das Haus auf dem Franzensring nur von außen kennen und auf die Lektüre der im Foyer hängenden Theaterzettel beschränkt sind.
Der Direktor hat vor diesem verarmten Publikum des Burgtheaters, den Angehörigen der geistigen Berufe, den Professoren, den Lehrern, den Richtern und den Aerzten, eine leichte und liebenswürdige Verbeugung gemacht und die ein wenig allgemein gehaltene Erklärung abgegeben, daß er in seinen Bemühungen, ihnen den Besuch des Burgtheaters wieder zu ermöglichen, nicht erlahmen werde. An diesen Bemühungen soll gewiß desgleichen nicht gezweifelt werden, wenn sie auch leider bisher keine besonders greifbaren Resultate gezeitigt haben. Wir wissen freilich genau, daß man uns vorrechnen wird, was alles zu Nutz und Frommen der verschiedenen Kunst- und Bildungsstellen geschehen sei, daß man mit bedauerndem Achselzucken hinzusetzen dürfte, ein Mehr verbiete sich aus naheliegenden Gründen budgetärer Natur. Nichtsdestoweniger wird es gut sein, den Direktor an sein zutreffendes, vielversprechendes und gewiß grundehrlich gemeintes Wort festzunageln und ihn in seinem gewiß nicht leichten Kampf gegen die verschiedenen Faktoren, die leider dreinzureden haben, Sekundantendienste zu leisten.
Trotz aller bisher aufgewendeten Mühen hat sich die Kluft, die zwischen dem Burgtheater und seinem ehemaligen Stammpublikum gähnt, keineswegs geschlossen. Im Gegenteil, sie ist noch breiter, noch unpassierbarer geworden, als es anfänglich der Fall gewesen ist. Und das Schlimmste ist darin gelegen, daß die ursprüngliche Erbitterung der Ausgesperrten in dumpfe Resignation umgeschlagen hat. Sie finden es beinahe selbstverständlich, daß das Burgtheater ihnen verschlossen ist. Sie haben einen dicken Strich unter ihre Burgtheaterschwärmerei von ehedem gemacht und haben sich leichter oder schwerer damit abgefunden, daß sie dort überhaupt nichts mehr zu suchen haben. Es muß jedoch nicht zum xtenmal betont werden, daß in solcher erzwungener Entfremdung der besten Elemente des Publikums die wirkliche, die ungelöste Burgtheaterkrise gelegen ist, eine Krise, die durch das Palliativmittel von so und so vielen Sitzen zu ermäßigten Preisen, die für irgendeine Lückenbüßervorstellung den Organisationen zur Verfügung gestellt werden, nicht aus der Welt geschafft werden kann.
Der Wiederaufbau des Burgtheaterpublikums von einst muß systematisch betrieben werden. Man darf nicht einmal vor der unleugbaren Tatsache zurückschrecken, daß just das verarmte Publikum des Burgtheaters zu seinem größten Teil sich nur am Sonntag den Theaterbesuch zu leisten vermag. Aus materiellen Gründen im allgemeinen und im besonderen deshalb, weil die Angehörigen der geistigen Berufe die Abendstunden der Wochentage zumeist jenen Nebenbeschäftigungen widmen müssen, auf deren Erträgnisse sie angewiesen sind. Das Defizit der Staatstheater würde aber dadurch kaum eine unerträgliche Steigerung erfahren, daß man sich gerade an Sonn- und Feiertagen an jene Schichten der Bevölkerung erinnert, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, in ihr Budget den Posten „Kulturbedürfnisse“ einzustellen.
Heute vor 100 Jahren: Der Siebenuhr-Ladenschluss
Wenn sogar die Straßenbahn eine Stunde länger als vergangenen Winter verkehren darf, so ist wirklich nicht einzusehen, warum nicht auch die Detailgeschäfte eine Stunde länger offenbleiben dürfen.
Neue Freie Presse am 1. September 1924
Wir erhalten folgende Zuschrift: „Bezugnehmend auf die ausgezeichneten Darlegungen des Herrn Dr. Rudolf Brichta in dem Leitartiekl Ihres sehr geschätzten Blattes vom 28. d., gestatte ich mir, darauf hinzuweisen, daß auch der Siebenuhrladenschluß einen dringenden Wunsch der Detailkaufmannschaft mindestens der Innern Stadt darstellt. Wie erinnerlich, bestand vor dem Kriege sogar der Achtuhrladenschluß, der infolge der durch die Kohlennot notwendigen Beleuchtungsersparnisse sukzessive der Sechsuhrsperre (vorübergehend sogar der Vieruhrsperre) Platz machen mußte. Nun ist es gerade in Anbetracht der Anwesenheit der ausländischen Delegierten vielleicht nicht unangebracht, daran zu erinnern, daß die Stunde von Sechs bis Sieben für den Verkauf an die kauflustigen Fremden erfahrungsgemäß in erster Reihe in Betracht kommt. Nach dem Five o‘clock-tea nehmen diese sich erst Zeit, nach Erledigung ihrer geschäftlichen Konferenzen oder Besichtigung der Sehenswürdigkeiten ihre Einkäufe in den Detailgeschäften vorzunehmen, und gerade da sind wir Kaufleute gezwungen, ihnen den Laden sozusagen vor der Nase zuzusperren.
Wenn jetzt sogar die Straßenbahn eine Stunde länger als vergangenen Winter verkehren darf, so ist wirklich nicht einzusehen, warum nicht auch die Detailgeschäfte eine Stunde länger offenbleiben dürfen, was uns überdies einen Schritt näher zu vorkriegsmäßigen Verhältnissen bringen würde. Es liegt dabei den Unternehmern vollkommen fern, dadurch den Angestellten ihre sozialpolitische Errungenschaft des Achtstundentages gefährden zu wollen, indem man entweder nach dem Berliner Beispiel es den Geschäften freistellen könnte, entweder von 8 bis 6 oder von 9 bis 7 offen zu halten, oder indem man im Winterhalbjahr von 9 bis 7 und im Sommerhalbjahr (15. April bis 15. September) von 8 bis 6 Uhr Geschäftszeit hätte.
Eventuell wäre auch die Einführung eines Schichtwechsels der Angestellten möglich. Es ist wohl zweifellos, daß bei gegenseitigem guten Willen die zur Milderung der herrschenden Absatzkrise gewiß beitragende Siebenuhrsperre im Interesse der schwerringenden Unternehmungen durch Verordnung der Landesregierung raschestens wieder eingeführt werden könnte, was gewiß von der gesamten Detailkaufmannschaft lebhaftest begrüßt werden würde. Ich wäre einer sehr geehrten Redaktion sehr dankbar, wenn sie diesen Bestrebungen eventuell durch Veröffentlichung in Ihrem führenden Blatte Ihre wirksame Unterstützung leihen würde und empfehle mich mit dem Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung ergebenst Ernst Förster, Prokurist der Firma A. Förster.“
Der Aufschwung Palästinas
Die jüdische Einwanderung nimmt stetig zu.
Neue Freie Presse am 31. August 1934
Gleichzeitig mit der Weltkonferenz der allgemeinen Zionisten haben hier die polnischen zionistischen Organisationen Polens Sitzungen abgehalten. Das Hauptreferat erstattete der Leiter des Einwanderungsamtes der Jewish Agency in Jerusalem, der Abgeordnete Grünbaum. Er berichtete über die Finanzlage in Palästina. Alte Defizite, sagte er, konnten gedeckt werden und in kurzem wird man von einer bedeutenden Anleihe hören, die uns auf dem Finanzmarkt von nichtjüdischer Seite angeboten wird.
Der Redner sprach sodann von Budgetüberschuß und den verschiedenen jüdischen Nationalfonds, besonders den Bodenkaufsfonds, deren Einkünfte dank der Steigerung der Beitragsleistungen auch seitens der notleidenden Judenschaft, insbesondere aus Südafrika, gewachsen sind. Im Zusammenhang mit dieser Prosperität stehe auch die Zunahme der Einwanderung, die alle Klassen umfasse und keine vorübergehende Erscheinung sei. 1932 seien sogenannte Zertifikate, das heißt Einwanderungserlaubnisse für Arbeiter ohne Kapital, in der Zahl von 10.000 ausgeteilt worden, 1933 betrug ihre Zahl schon 40.000.
Auch die Zahl der „Kapitalisten“ (Kapital 3000 Pfund) und der „Handwerker“ (Kapital 250 Pfund) nehme zu. Grünbaum besprach sodann das geplante Legislative Council in Palästina und drückte den Wunsch aus, man möge mit seiner Einführung warten, bis die Bevölkerungsziffer der Juden ihrem wirtschaftlichen Einfluß entspreche. Nach Grünbaum sprach der Londoner Mathematiker und Zionistenführer Brodetzky über die noch vorhandene Aufnahmsfähigkeit Palästinas. Er erklärte, daß Haifa heute der wichtigste englische Hafen im Mittelmeer sei und daß Palästina nicht mehr zu Asien gehöre, sondern europäisches Gebiet geworden sei. Dies sei auch der tiefere Grund für die Rivalität zwischen Europäern und Arabern.
Arbeitslose als Archäologen
Die jungen Leute sind von ihrer eigenartigen und spannenden Arbeit ganz fasziniert und werden ihrer nicht müde.
Neue Freie Presse am 30. August 1934
In der Nähe des Clarendon-Palastes, drei Meilen von Salisbury entfernt, wurden Ausgrabungen veranstaltet, die eine große Zahl von Objekten ans Tageslicht förderten. Fast hundert Arbeitslose, von denen die wenigsten das zweiundzwanzigste Lebensjahr überschritten haben, hatte man aus London, Swindon, Portsmouth und Wales geholt und ihnen ein großes Lager in der Nähe der Ausgrabungsstätte errichtet. Sie standen den Gelehrten mit der Aufräumung der tieferen Schichten zur Seite, sie fällten Bäume und rodeten Wurzeln aus. Sie bauten sich sogar eine kleine Feldbahn, um den Ballast leichter abtransportieren zu können.
Diese jungen Menschen gehören, wie der „Times“-„Neue Freie Presse“-Dienst meldet, zu einem der zehn Lager, die von dem „Kongreß der Universitäten für Arbeitslosenlager“ eingerichtet wurden. Zweiundzwanzig Studenen vom Londoner King‘s College sind auch dabei und ihr Lagerchef ist J. R. Paget. Männer aus der Umgebung werden zur Verrichtung der groben Arbeit herangezogen und die Arbeitslosen werden mit Aufgaben beschäftigt, die sonst in diesem Jahr nicht durchgeführt worden wären. Die ersten Ausgrabungen in dieser Gegend unternahm Sir Thomas Phillipps schon 1821, aber seine Funde sind verloren gegangen. Erst im vorigen Jahr entdeckte Dr. Tancred Borenius die ergiebige Fundstelle wieder. Borenius ist Professor der Kunstgeschichte an der Londoner Universität und der erste Assistent von John Charlton, dessen Namen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der königlichen Kommission für vorgeschichtliche und geschichtliche Denkmäler in ganz Großbritannien den besten Klang hat.
Die jungen Leute sind von ihrer eigenartigen und spannenden Arbeit ganz fasziniert und werden ihrer nicht müde. Jeden Abend schließen sie im Lager neue Wetten über die Funde des nächsten Tages ab und nicht selten soll es vorkommen, daß ein besonders schönes Ausgrabungsergebnis den Gewinner so großmütig macht, daß er auf seinen Gewinn verzichtet.
Einführung der elektrischen Beleuchtung in zwölf Wiener Bezirken
Die Ersetzung der Gasbeleuchtung durch elektrisches Licht schreitet voran.
Neue Freie Presse am 29. August 1924
Die Ersetzung der Gasbeleuchtung durch elektrisches Licht wird wieder in einer Anzahl weiterer Bezirke durchgeführt werden. Es kommen jetzt die folgenden Straßenzüge an die Reihe:
Innere Stadt, Wieden und Mariahilf (friedrichstraße-Lastenstraße, Rechte Wienzeile, Getreidemarkt), Neubau (Kaiserstraße), Josefstadt (Blindengasse), Alsergrund (Spitalgasse), Hietzing, Rudolfsheim, Fünfhaus (Jörgerstraße-Hernalserstraße), Währung (Währingerstraße), und Döbling (Schreiberweg, Kaasgrabengasse, Weg bei der Sieveringerstraße).
In manchen Teilen der erwähnten Straßen ist die elektrische Beleuchtung zum Teil schon vorhanden, sie wird dann eben jetzt bis zum Ende geführt. An Kreuzungsstellen werden Lichtmaste angebracht und dort, wo solche alte Typs stehen wie auf dem Getreidemarkt-Friedrichstraße, werden sie gegen Maste des neuen Typs ausgewechselt.
Das Pariser Sportmädel
Marcel Prévost spricht die Befürchtung aus, dass die gegenwärtige Hypertrophie des Sports aus den graziösen Pariserinnen ein Amazonenheer von Athletinnen machen werde.
Neue Freie Presse am 28. August 1924
Paris war vor dem Kriege keine sehr sportliebende Stadt, hat sich aber seither in dieser Beziehung gründlich geändert. So begrüßenswert diese Entwicklung ist, sie schießt dennoch mitunter übers Ziel hinaus, und Marcel Prévost stellt in der von ihm geleiteten „Revue de France“ einigermaßen elegische Betrachtungen über das Pariser Sportmädel an. Der Romancier gibt bereitwillig zu, daß das Sportmädel von heute ein viel gesünderer Typus ist, als die schöngeistigen und flirtenden Mädchen von vorgestern; aber er spricht die Befürchtung aus, daß die gegenwärtige Hypertrophie des Sports aus den graziösen Pariserinnen ein Amazonenheer von Athletinnen machen werde.
„Bedenken Sie doch nur, meine Damen und Herren“, schreibt Prévost, „wieviel Zeit gegenwärtig eine mondäne junge Pariserin für ihre Toilette, für Kosmetik und Hygiene, für das Bad, für Autotouren, Tennis, Golf und für die modernen Tänze braucht, rechnen Sie die unumgänglich nötige Zeit für den Schlaf und die Mahlzeiten hinzu – und Sie werden zu dem Ergebnis kommen, daß dem braungebrannten Sportmädel mit den muskulösen Armen fast gar keine Zeit für Bücher bleibt. Auch die Liebe kommt dabei zu kurz, wenn die Mädchen fast ausschließlich von dem Gedanken beherrscht sind, einen sportlichen Rekord aufzustellen. Gewiß war auch der Blaustrumpf, die Aesthetin, keineswegs das Ideal der Weiblichkeit. Aber zwischen Blaustrumpf und Athletin muß es doch einen goldenen Mittelweg geben.“
Prévost verweist darauf, daß sich die jungen Pariserinnen von heute nicht für irgendeine berühmte Schauspielerin, sondern für den weiblichen Tennischampion Suzanne Lenglen bis zur Weißglut begeistern. Sie interessieren sich für Kunst und Literatur weit weniger, als für Tennisturniere, olympische Spiele und Golfmatches. Allerdings hebt Prévost auch hervor, daß das Pariser Sportmädel sich auch nicht fürs Tingeltangel, fürs Kabarett, für schwüle Konversation interessiert – und das sei ein Vorzug, der manches Manko aufzuwiegen vermöge.
Gefährdung der Europäer in Afghanistan
Fanatiker standen im Begriffe, ein allgemeines Massaker aller Christen im Lande zu veranstalten.
Neue Freie Presse am 27. August 1924
Soeben trafen Meldungen aus Indien ein, die zum erstenmal enthüllten, daß vor 14 Tagen alle Europäer in Kabul aufs ernsthafteste bedroht waren.
Die Ursache war ein Todesurteil, das von afghanischen Behörden gegen einen italienischen Ingenieur wegen Totschlages verhängt worden war. Aus Rom war darauf ein Telegramm eingetroffen, in dem mit strengsten Gegenmaßregeln gegen alle Muselmanen in den italienischen Kolonien gedroht wurde, falls das Todesurteil ausgeführt würde.
Diese Drohung bezweckte jedoch, nur den Zorn der Fanatiker in Afghanistan anzufachen, die im Begriffe standen, ein allgemeines Massaker aller Christen im Lande zu veranstalten. Mehrere Tage hindurch war die Lage aufs äußerste bedrohlich, und selbst jetzt ist es noch nicht bekannt, ob die Gefahr endgültig vorüber ist. Der verurteilte Italiener befindet sich noch immer im Gefängnis.
Das teure Gastein
Es gibt wenige Orte in Europa, wo man mehr ausgeben kann, als in Gastein, und vielleicht keinen, wo man so viel ausgeben muss.
Neue Freie Presse am 26. August 1924
Von befreundeter Seite wird uns geschrieben: „Die Hochsaison in Bad Gastein nähert sich ihrem Ende; das heißt, ein Reisender, der in diesen Tagen dort ankommt, ohne sich vorher ein Zimmer gesichert zu haben, hat einigermaßen Aussicht, ein solches für Geld und gute Worte – namentlich für Geld! – zu bekommen, während er noch vor 14 Tagen gezwungen war, mit dem nächsten Zuge nach Mallnitz oder Lend zu fahren und dort – auch nicht mit garantiertem Erfolg – auf die Suche nach einem Quartier zu gehen.
Gastein war diesmal überfüllt, obwohl in den letzten Jahren viel an- und zugebaut worden ist (nicht zum Vorteil der landschaftlichen Schönheit, die, wenn das weiter so fortgeht, ernstlich bedroht erscheint), und obwohl die Preise für Zimmer, Verpflegung und Bäder eher etwas Abschreckendes haben. Allgemein hat man über die Teuerung lamentiert. Es gibt auch sicher wenige Orte in Europa, wo man mehr ausgeben kann, als in Gastein, und vielleicht keinen, wo man so viel ausgeben muß. Man begreift freilich vieles, wenn man hört, daß zum Beispiel den Hoteliers von ihren Zimmer- und Bäderpreisen nur wenig mehr als die Hälfte bleibt, da sie volle 40 Prozent davon an die Gemeinde abliefern müssen.
Und auch noch in anderer Beziehung verlieren die hohen Ziffern wenigstens teilweise ihren Schrecken; es gibt hier, zum Unterschied von der in anderen österreichischen Sommerfrischen und Kurorten herrschenden üblen Gepflogenheit, keine Kur-, Musik- oder sonstige Fremdentaxe, keine Beiträge zum „Verschönerungsverein“ oder für das Armenhaus; ja selbst die Trinkgelder, sowohl in den großen Hotels wie auch in den bescheidenen Gasthöfen, sind genau vorgeschrieben. Der Kurgast wird also nicht „zizerlweise“ gerupft, was immer ärgerlich macht, sondern radikal behandelt. Nach dem ersten Schrecken ist das weit sympathischer.
Uebrigens läßt sich die Gemeinde nicht spotten; Wege, Bänke u. dgl. sind in vorzüglichem Stande, auch die Kurkapelle ist ausgezeichnet. Merkwürdig berührt den Wiener, der gewohnt ist, Geschäfte und Läden von 5 Uhr ab schließen zu shen, der nächtliche Glanz der Schaufenster, die hier manchmal bis 10 Uhr und länger offen bleiben. Auch wundert man sich, daß ein Ort, dessen finanzielle Höhenlage seiner geographischen zum mindesten entspricht, vorzugsweise von Fremden besucht wird aus Ländern, die so ziemlich die schlechtesten Valuta haben. Man hört hier hauptsächlich berlinerisch und ungarisch sprechen; oder sollte einem das nur so scheinen, weil diese Sprachen bekanntlich besonders laut gesprochn zu werden pflegen? Es ist freilich sonderbar genug, daß allen ausgesprochenen wirtschaftlichen Kreisen, allen ungelösten politischen Spannungen zum Trotz, gerade die teuersten Kurorte in diesem Sommer besuchter waren, als jemals in den letzten zehn Jahren; eine schwer erklärliche Erscheinung, die aber dabei entschieden etwas Beruhigendes hat.“
Völkerbund-Delegierte prüfen Österreichs Wirtschaft
Die Finanzdelegierten wollen sich ein Bild über die gesamte Finanz- und Wirtschaftslage Österreichs machen.
Neue Freie Presse am 25. August 1924
Heute sind bereits mehrere Mitglieder der Delegation des Völkerbundes eingetroffen. In den Kreisen des Völkerbundes sieht man der Arbeit der Finanzdelegierten in Wien mit großem Interesse entgegen. Man ist hier überzeugt, dass die Delegation in Wien vor einer bedeutsamen und sehr verantwortungsvollen Aufgabe steht. Die Delegation kommt mit einer freundlichen Gesinnung für Österreich nach Wien und hat die bestimmte Absicht, die ganze Lage des Landes genau zu prüfen, nicht nur die finanzielle Situation, sondern auch die Lage auf dem Gebiet der Privatwirtschaft, auch der Banken, wobei besonders beobachtet werden wird, wie sich das Wirtschaftsleben Österreichs in den Ziffern der Nationalbank spiegelt.
Die Mitglieder des Finanzkomitees werden nicht nur das ihnen von der Regierung vorgelegte Elaborat und die darin enthaltenen Ziffern und statistischen Berechnungen eingehen prüfen, um zu der Festlegung eines Normalbudgets zu gelangen, sondern beabsichtigen, auch mit den Vertretern der Privatwirtschaft und verschiedene Kooperationen eingehende Rücksprachen zu pflegen. Sie wollen zu diesem Zwecke mit den Vertretern der Handelskammern, der Arbeiterkammer, der Industrie und der Kaufmannschaft Konferenzen abhalten, um ein allgemeines klares Bild über die gesamte Finanz- und Wirtschaftslage Österreichs und deren Aussichten für die nächste Zukunft zu gewinnen.
Wie hier angenommen wird, dürfte der Aufenthalt der Finanzdelegierten des Völkerbundes in Wien 10 bis 14 Tage dauern, worauf sich die Kommission nach Genf begeben wird, um ihre Wiener Eindrücke dem österreichischen Komitee und dem Kontrollkomitee des Völkerbundes zu berichten, die dann eine Resolution dem Völkerbund Rat zur Beschlussfassung vorlegen werden.
Schatzsuche in der Südsee
Ein englischer Forscher sucht mit Privatjacht und Flugzeug nach Piratenschätzen..
Neue Freie Presse am 24. August 1934
Aus London wird berichtet: Nach monatelangen Vorbereitungen ist dieser Tage, wie gemeldet, der englische Forscher Stratford D. Jolly mit seiner 400 Tonnen großen Privatjacht „Queen of Scotland“ und einer Besatzung von 45 Mann nach den Kokosinseln ausgelaufen, um dort nach den sagenhaften Schätzen der Piraten zu suchen, die dort vor Jahrhunderten ihre Schlupfwinkel hatten.
Schon immer haben die angeblich von Piraten dort verborgenen Goldschätze in den Köpfen Abenteuerlustiger eine hervorragende Rolle gespielt. Stratford will jetzt in den Besitz der genauen Pläne der Insel mit den eingezeichneten Verstecken gekommen sein. Angeblich sollen Schätze im Wert von 100,000.000 Dollar auf den Kokosinseln verborgen sein, die aus den Raubüberfällen der Flibustier auf die spanischen Goldtransportschiffe stammen.
Stratford hat seine Expedition mit allen Neuerungen moderner Technik ausgestattet. Zur Finanzierung der Schatzsuche hat er die Schatzbergungsgesellschaft mit einem Kapital von 75000 Pfund Sterling gegründet. Zum erstenmal ist bei der Expedition auch das Flugzeug in den Dienst der Suche nach verborgenen Schätzen gestellt worden. Die „Queen of Scotland“ hat ein kleineres Flugzeug an Bord, das den Schatzsuchern die Auffindung des Goldversteckes in dem gebirgigen Gelände der Kokosinseln wesentlich erleichtern soll. Außerdem werden bei der Suche nach den Piratenschätzen elektrische Registrierapparate, Wünschelruten und andere Hilfsmittel der modernen Technik Verwendung finden.
Ein Golfplatz als Köder
Um mehr internationale Gäste auf sich aufmerksam zu machen, plant Florenz die Errichtung eines „sportlichen“ Bauwerks.
Neue Freie Presse am 23. August 1934
In Florenz wird ein neuer Golfplatz eröffnet, dessen Beschaffung dem Staatlichen Verkehrsamt zu danken ist. Er dürfte besonders auf die zahlreichen in Florenz lebenden Ausländer eine große Anziehungskraft ausüben. Der Golfplatz des Ugolino liegt an der Strecke nach Chianti und ist von Florenz aus mit dem Auto in einer Viertelstunde zu erreichen. Das Gelände umfaßt 88 Hektar. Die 18 Löcher verteilen sich auf eine Strecke von 5455 Meter.
Die Anlage des Platzes, die von englischen Fachleuten ausgeführt ist, wird allen Ansprüchen gerecht, die bei internationalen Turnieren gestellt werden. Für die Bewässerung der Wiesen dienen fünf Brunnen mit Motorpumpen. Zum Golfplatz gehören ein Klubhaus mit Bädern, Restaurant und Bar, ein Tennisplatz mit allen Einrichtungen für Meisterschaftsspiele und ein offenes Schwimmbad, dessen Bassin 25 Meter lang, 12‘5 Meter breit und bis 3‘7 Meter tief ist. Es ist mit Sprungbrettern von 1‘5 Meter und 3 Meter Höhe ausgestattet,
Damit besitzt Floren einen der schönsten Golfplätze Italiens. Er ist mit der Stadt durch eine bequeme Straße verbunden und liegt in einem herrlichen landschaftlichen Rahmen.
Hosen à la Chaplin
Der bekannte Schauspieler Charlie Chaplin steht vor Gericht – als Kläger.
Neue Freie Presse am 22. August 1924
Aus Newyork wird gemeldet: Wie die Blätter berichten, fand dieser Tage in der Filmstadt Los Angeles ein Prozeß vor dem dortigen Tribunal statt, in welchem die weltbekannten, charakteristischen Beinkleider des Filmschauspielers Charlie Chaplin das Streitobjekt bildeten.
Als Kläger in diesem Prozeß trat Charlie Chaplin auf, als Geklagter hatte sich ein kleiner Filmschauspieler zu verantworten, der sich einen ähnlich klingenden Künstlernamen ueberlegt hat und überdies so vermessen war, in Hosen à la Chaplin aufzutreten, Charlie Chaplin verlangte einen Gerichtsbeschluß, mit welchem seinem Nachahmer verboten werden soll, die weite karierte Hose zu tragen, deren Schnitt, wie Chaplin behauptet, seine eigene Erfindung ist.
Der Beklagte verteidigte sich mit dem Einwand, daß das gewohnte Kostüm Charlies durchaus keinen Anspruch auf besondere Originalität erheben könne, weil schon im Jahre 1889 ein amerikanischer Komiker in Chicago mit den gleichen Hosen aufgetreten ist und das Publikum zum Lachen hinriß. Das Gericht vertagte die Verhandlung über diesen eigenartigen Urheberrechtsprozeß und beschloß, die Einvernahme von Sachverständigen aus der Film- und Artistenbranche. Charlie Chaplin hat bereits vor einem Jahr einen ähnlichen Prozeß zu dem urheberrechtlichen Schutz seiner Kleidung vor einem amerikanischen Gericht glänzend gewonnen.
Kampf um das Priesterzölibat in England
Ein junger Pastor möchte heiraten und darf eigentlich auch heiraten – wenn da nicht dieser Widerstandbrief wäre.
Neue Freie Presse am 21. August 1924
Soll eine der wichtigsten Errungenschaften der Reformation rückgängig gemacht werden? Wenn es nach dem Willen der Gemeindes von der St. Paulskirche in Brigton ginge, so würde in der anglikanischen Kirche wieder der Zölibatszwang eingeführt. Nun das Rad der Geschichte läßt sich zwar nicht nach rückwärts drehen, aber immerhin hat die Affäre von Brighton in ganz England eine lebhafte Diskussion hervorgerufen und uraltes Gezänk um ein Problem, das für die anglikanische Kirche längst gelöst zu sein schien, lebt wieder auf.
Und all dies geschieht, weil der Bischof von Willensden, der sich der größten Volkstümlichkeit erfreut, dem jungen Pastor Olivier, der knapp vor seiner Verheiratung war, zum Seelsorger der St. Paulskirche in Brighton ernannte. Der junge Priester bekam folgenden mit mehreren hundert Unterschriften gefertigten Brief:
„Euer Ehrwürden, wir haben aus den Zeitungen von Ihren Heiratsabsichten erfahren. Da wir die Ehe mit der Stellung eines Pastors für unvereinbar halten, bitten wir Sie um die Mitteilung, ob Sie wirklich heiraten wollen. Sollte dies der Fall sein, so müßten wir zu unserem Bedauern gegen Ihren Amtsantritt feierlich Einspruch erheben. Falls Sie aber dennoch auf Ihrem Entschlusse beharren, so teilen wir Ihnen schon jetzt mit, daß wir in diesem Falle aus der anglikanischen Kirche austreten werden.“
Der junge Pastor konnte sich diesen Brief nicht erklären, da sich bisher in den anglikanischen Gemeinden gegen die Priesterehen noch niemals ein Widerstand geltend gemacht hatte. Er erfuhr bald, daß sein früherer Seelsorger, namens Wagner, der unverheiratet und ein fanatischer Anhänger des Zölibats gewesen war, nach und nach die ganze Gemeinde zu seiner Ansicht bekehrt hatte.
Nun wandte sich Pastor Olivier an den Bischof von Willensden mit der Bitte, in diesem Konflikte eine Entscheidung zu treffen. Der Bischof erklärte, der Pastor sei rechtsgültig für sein Amt eingesetzt und auch vollkommen berechtigt, eine Ehe einzugehen. Der Einspruch er Gemeinde sei irrelevant. Aber der Pastor fühlte, daß ein gedeihliches Zusammenarbeiten mit der Gemeinde nur dann möglich sei, wenn dieser prinzipielle Konflikt aus der Welt geschafft sei, und er lud Vertreter der Gemeinde zu einer Besprechung ein und setzte ihnen alle Argumente gegen den Zölibatszwang auseinander.
Aber die Leute blieben bei ihrer vorgefaßten Meinung und waren durch keine Gegengründe zu überzeugen. Da der Pastor die Aussichtslosigkeit weiterer Besprechungen einsah, verzichtete er auf seinen Amtsantritt und führte bald darauf seine Braut heim. Nun setzte im ganzen Lande ein lebhaftes Für und Wider der Meinungen ein.
Die Auffindung des Ur-Hamlet
Endlich gibt es Antworten auf Fragen rund um Shakespeare.
Neue Freie Presse am 20. August 1924
Einem Gelehrten, der in der Bibliothek der Oxforder Universität die Handschriftensammlung nach unveröffentlichten Dokumenten des Elisabethinischen Zeitalters durchstöberte, ist kürzlich ein Fund geglückt, der auf bisher ungelöste Fragen der Shakespeare-Forschung Antwort gibt.
Der Philologe fand ein vergilbtes Manuskript in englischer Sprache, das mit lateinischen Randbemerkungen versehen ist. Dieses Manuskript trägt den Titel „Der bestrafte Brudermörder“ oder „Prinz Hamlet von Dänemark“. Es handelt sich um das Drama, dem Shakespeare die Anregung und den Stoff zu seiner Tragödie entnommen hat.
Freilich hat Shakespeare der düsteren Begebenheit nicht nur den Zauber seiner dichterischen Gestaltungskraft und den Reichtum philosophischer Reflexionen verliehen, sondern er hat auch mit schöpferischer Souveränität die Handlung vielfach umgestaltet. So ist beispielsweise im Ur-Hamlet Ophelia eine komische Figur, eine Pierette. Ueberhaupt verhält sich dieses Hamlet-Drama zu Shakespeares „Hamlet“ ungefähr ebenso wie die volkstümlichen Faust-Dichtungen zu Goethes „Faust“.
Das Drama, das vier Jahrhunderte lang verschollen gewesen war, gelangte kürzlich im Oxforder Stadttheater mit starker Wirkung zur Ausführung.
Staatsgefahr durch Melonen?
Ein jüdischer Kaufmann wurde in Ungarn wegen einer Melone verhaftet.
Neue Freie Presse am 19. August 1924
Unser Budapester Korrespondent berichtet: Wie bereits gemeldet, wurde der Gemischtwarenhändler Alois Friedmann in Aszod wegen Verschleißes von angeblich staatsgefährlichen Melonen verhaftet. Die Anzeige erstatteten zwei junge Leute, die behaupteten, dass die Melonen mit einem Sowjetstern versehen worden seien.
Der Untersuchungsrichter unterzog heute Friedmann einem Verhöre und konstatierte an Hand des Corpus Delicti einer sieben Kilo schweren Wassermelone, dass der inkriminierte Sowjetstern dort nicht zu sehen war. Das Zeichen, das in der Ritze der Melone angebracht war, sei aber auch mit dem Davidschilde nicht identisch. Der Untersuchungsrichter ordnete daher die Freilassung Friedmanns an, mit der Begründung, dass auch ein jüdischer Stern auf der Melone gegebenenfalls keine Aufreizung gegen die staatliche Ordnung involvieren würde.
Nach gestrigen Meldungen haben an dem Tage, als Friedmann verhaftet wurde, judenfeindliche Demonstrationen in Aszod stattgefunden. Die Fenster jüdischer Häuser wurden eingeschlagen.
Die Ohnmacht und das Recht
Ein Herrenfahrer, der am Steuer ohnmächtig wurde, stand vor Gericht.
Neue Freie Presse am 18. August 1934
Plötzlich wird es dunkel. Alle Geräusche mischen sich zu einem dumpfen, verworrenen Brausen. Das Bewusstsein schwindet. Von kaltem Wasser oder vom scharfen Geruch des Essigs oder von einem herzstärkenden Mittel geweckt, kommt man allmählich wieder zu sich. Die Zeit, die man in tiefer Bewusstlosigkeit verbracht hat, ist ungelebtes Leben, aus dem Zusammenhang der Existenz gerissen, sozusagen atemkurzer Ausflug in die Ewigkeit. Die Jurisprudenz aber lässt sich dadurch nicht imponieren, sondern fragt nüchtern und sachlich: Wie lässt sich eine Ohnmacht in den Organismus des Rechtes eingliedern? Ist sie ein unvorhergesehenes Ereignis, ein Blitz aus heiterem Himmel? Oder ist sie ein Zwischenfall, den man, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, vorhersehen und vorausberechnen kann und für den man daher haftet?
Den Anlass zum Rechtsstreit um eine Ohnmacht bildete ein Autounfall, über dessen gerichtliches Nachspiel gestern berichtet wurde. Ein Herrenfahrer hatte den sportlichen Ehrgeiz, sich trotz seiner Übermüdung nicht ablösen lassen zu wollen. Er verlor infolge des Ohnmachtsanfalles die Herrschaft über seinen Wagen und verursachte dadurch schwere Verletzungen seines Chauffeurs. Haftet er für Schadenersatz? Nein, sagten die unteren Instanzen. Ja, sagte der Oberste Gerichtshof. Der Herrenfahrer hatte sich zu viel zugemutet. Folglich musste er mit der Möglichkeit einer Ohnmacht rechnen.
Ein Urteil, das sich freilich nicht ohne weiteres verallgemeinern lässt. Es gibt Ohnmachten, die den Menschen überfallen, wann es ihnen beliebt, und die sich um keinen Paragraphen kümmern. Nur eine einzige Art von Ohnmacht lässt sich mit mathematischer Sicherheit vorausberechnen: Der als beliebtes Lustspielrequisit verwendete Ohnmachtsanfall der Gattin, die einen neuen Hut haben möchte. Diese uralte Witzblattpointe trifft mit absoluter Pünktlichkeit ein. Sonst aber gibt es nur allzu viel Ohnmachtsanfälle, deren unvermuteter Plötzlichkeit man sich völlig ohnmächtig gegenübersieht.
Erneuerung der Uhr am Rathausturm
Die Rathausuhr war veraltet, aber auch seit jeher in ihrer Konstruktion verfehlt.
Neue Freie Presse am 17. August 1924
Trotz aller Sorgfalt, die auf die Rathausuhr als eine der wichtigsten öffentlichen Uhren Wiens verwendet wird, war es bisher nicht möglich, ihren störungslosen und vollkommen richtigen Gang zu sichern. Die Rathausuhr war veraltet, aber auch seit jeher in ihrer Konstruktion verfehlt. Das Uhrwerk war zu schwach, die Zeiger zu groß und wirkten besonders bei stärkeren Windstößen auf jenes ein, so daß immer wieder Störungen und Beschädigungen an der Turmuhr entstanden.
Deshalb wurde nun in der letzten Sitzung des technischen Ausschusses des Gemeinderates beschlossen, die jetzige Turmuhr des Rathauses durch eine neue Uhr modernster Bauart mit Synchronisierungseinrichtungen zu ersetzen und die alte Uhr, die in historischer Hinsicht sowie wegen ihrer Konstruktion interessant ist, dem Wiener Uhrenmuseum zu überweisen. Die neue Uhr wird ein Viertel- und Stundenschlagwerk haben und an die Synchronisierungsanlage entweder der „Urania“ oder der Feuerwehr, also jedenfalls an die Sternwarte, angeschlossen werden. Sie soll bereits in sechs Wochen die richtige Zeit zeigen. Die Kosten dieser neuen Rathausuhr belaufen sich auf 58 Millionen Kronen.
Schneesturm auf dem Matterhorn
Mitten im Hochsommer wurden elf Touristen überrascht.
Neue Freie Presse am 16. August 1924
Auf dem Matterhorn sind nach einer Meldung der „Tribuna de Geneve“ 11 Touristen in der Solvayhütte auf dem Hörnlig in einer Höhe von 4100 Meter von einem Schneesturm überrascht und vollkommen blockiert worden. Sie konnten bis heute nachmittag nicht befreit werden, obwohl bereits heute früh aus Zermatt eine Führerkolonne zur Bergung der Eingeschneiten aufgebrochen ist. Die Befürchtungen für das Leben der Touristen sind um so größer, als die Solvayhütte nur wenigen Menschen für äußerste Not Raum gewährt und 11 Touristen darin kaum stehend Platz finden können.
Heute vor 90 Jahren: Brünette bevorzugt
Die Männer bevorzugen Blondinen, hieß es – und die Frauen und Mädchen eilten zum Friseur. Teils führte das zu clownesken Zuständen. Nun scheint sich das Blatt zu wenden.
Neue Freie Presse am 15. August 1934
„Bitte, geben Sie sich mit meinem Haar alle Mühe. Ich möchte möglichst leuchtendes Blond.“ Derartige Wünsche brünetter Damen waren noch vor ein paar Monaten beim Friseur an der Tagesordnung. Alle Welt schwärmte für Blond. In Newyork und in Rio de Janeiro, in Paris und in Kapstadt legten die Mädchen und Frauen, denen die Natur goldfarbenes Haar versagt hatte, höchsten Wert darauf, recht gründlich zu „erblonden“.
„Die Herren bevorzugen Blondinnen – gentlemen prefer blondes“ – dieser Titel des vielgelesenen Romans von Anita Loß war zum weltbeherrschenden Modeschlagwort geworden. Im Restaurant, im Theater, auf dem Rennplatz, auf der Strandpromenade sah man fast überhaupt nur mehr Blondinen. Man kann nicht behaupten, daß dieses möglichst alarmierende und auffallende Blond all seinen Trägerinnen gleich gut zu Gesichte stand. Zuweilen war die Färbung einigermaßen mangelhaft, so daß das Haar in allen Schattierungen prangte und clowneske Wirkungen hervorrief.
Aber auch wenn ein naturechtes Blond erzielt wurde, wirkte es zu manchem Gesicht, das mit dunklem Haar ungemein reizvoll aussah, störend und unorganisch. Daneben gab es freilich zahllose Blondinen, deren künstliches Blond von echtem durchaus nicht zu unterscheiden war und die mit ihrer neuen Haarfarbe bildhübsch aussahen.
Nun aber ist, wie Pariser Blätter berichten, eine Götterdämmerung über die Blondinen hereingebrochen. Man ist des blonden Haares überdrüssig geworden, man ist übersättigt, blond wird als langweilig empfunden. Viele Blondinen, die noch vor Kurzem um die Echtheit ihrer strahlenden Haarfarbe allgemein beneidet wurden, lassen sich jetzt ihr Haar dunkel färben. Die brünette Mode hat von Newyork und Hollywood ihren Ausgang genommen, wo die Herrschaft des holdseligen Blond nunmehr von einem Triumph des dunklen Haares abgelöst worden ist.
Die Devise „Brünette bevorzugt“ ist in der letzten Zeit auch in Paris ein populäres Schlagwort geworden. Die Nuance, die von mondänen Frauen gegenwärtig als Haarfarbe am meisten bevorzugt wird, ist ein sattes Dunkelbraun, ein kreolisches Blauschwarz und das funkelnde südländische Schwarz schöner Italienerinnen und Spanierinnen.
Wien, die Stadt der Daheimgebliebenen
Die Zeiten, in denen man sich aus Prestigegründen schämte, den Sommer in Wien zu verbringen, sind vorüber.
Neue Freie Presse am 14. August 1924
Nach dem Pariser Vorbild des „Salons der Zurückgewiesenen“ macht man aus der Not eine Tugend. Die Stadt der Daheimgebliebenen als die sich Wien heiter präsentiert, trägt ihr Schicksal mit guter Laune. Die Ansichtskarten die von den diversen Urlaubsorten eintreffen und die ja meistens nichts anderes als wehmütige Variationen über trostlose Wetterberichte sind, bieten ja auch wahrhaftig keinen Anlaß zum Neid. Die Zeiten, in denen man sich aus Prestigegründen schämte, den Sommer in Wien zu verbringen, sind vorüber, und das vielzitierte Ehepaar, dem die leere Brieftasche den Landaufenthalt verwehrte und das den Sommer bei herabgelassenen Rouleaus in der Wohnung verbrachte, um nicht von Bekannten gesehen zu werden, gehört der Sage an.
Heuer sieht man viel wenigen herabgelassene Rouleaus oder verpickte Fenster als ehedem, und offenbar ist die kühle Witterung daran schuld, daß die Stadt nicht in jenen Sommerschlaf verfallen ist, den sonst Naphthalingerüche zu umspielen pflegten.
Wien hat sich heuer in eine große mondaine Sommerfrische verwandelt, und wenn abends beim Konzert im Stadtpark die Lampen durch das Gebüsch glühen und helles Mädchenlachen die liebliche Begleitmusik zum Spiel der Kapelle ist, bedarf man keiner besonderen Illusionsfähigkeit, um sich auf irgendeine Eiplanade oder Kolonade zu träumen. In den Wiener Gärnten entfalten sich richtige Sommerfrischeidyllen, namentlich im Prater sieht man mitunter in grünen Winkeln zwischen Bäumen aufgespannte Hängematten, auf denen Männlein und Weiblein mit dem nötigen Proviant und allenfalls einem Leihbibliotheksband versehen, ganze Urlaubstage verbringen. Der Belvederepark ist der Park der Kinder. Zierliche Kinder bilden förmliche Barrikaden, die Bänke sind mit Gouvernanten bevölkert und die Kinder bauen aus Sandhaufen Gebirge, die ihnen schöner erscheinen als die Dolomiten.
Der Volksgarten ist der Jardin de Luxembourg von Wien. Hier merkt man, daß jetzt Universitätsferien sind. Bei Tage sieht man hier meistens Studenten mit Skripten, und erst abends, wenn Musik herüberklingt, besinnt sich die Jugend daraus, daß sie das Recht hat, verliebt zu sein. Schönbrunn beginnt allmählich seinen Charakter eines Pensionistenparadieses zu verlieren. In keinem Parke kann man soviel Fremde sehen, soviel Sprachen hören wie hier. Schönbrunn steht gegenwärtig unter dem Zeichen des rotgebundenen Baedeckers.
Die Liebestragödie des „roten Zwerges“
In Neapel tragen sich gerade Dinge zu, die aus der Feder eines Schriftstellers stammen könnten. Aber nein: Es sind Tatsachen.
Neue Freie Presse am 13. August 1924
An das tragische Schicksal des mißgestalteten Zwerges in Viktor Hugos „Glöckner von Notre Dame“ erinnert die Tragödie eines Krüppels, die jetzt in Neapel allgemeines Mitgefühl erweckt. Den unter dem Namen des „roten Zwerges“ bekannte Filmschauspieler Mario Croce hat sich aus einem Revolver zwei Kugeln durch die Brust gejagt und wurde mit einer lebensgefährlichen Lungenverletzung ins Spital gebracht, wo er mit dem Tode ringt. Dieser Revolverschuß bedeutet den Schlußpunkt unter der Tragödie eines Lebens, wie es bizarrer kein Dichter hätte ersinnen können.
Croce stammt aus einer Familie, auf der ein wahrer Fluch zu lasten scheint. Sein Großvater war der General Croce, der langjährige Kommandant der königlichen Garde. Eines Tages schoß sich der Offizier, der sich in glänzender Stellung und in den angenehmsten gesellschaftlichen Verhältnissen befand, eine Kugel durch den Kopf. Auch sonst schien ein düsteres Verhängnis auf dieser Familie zu lasten. Kranke Kinder kamen zur Welt, zeigten im Heranwachsen beunruhigende Symptome von Schwermut oder Wahnvorstellungen und körperliche Entartungserscheinungen. Auch ging es mit dem Vermögen der Familie schnell bergab. Aus Mario Croce schien sich alles Unglück, das seine Familie verfolgte, zu konzentrieren.
Mit seiner Größe von einem Meter zwanzig Zentimeter behielt er zeitlebens den Wuchs eines zehnjährigen Knaben. Der unförmige rothaarige Kopf kontrastierte grotesk zu dem kleinen verwachsenen Körper, an dem zwei spinnwebdünne Arme schlenkerten. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn Croce, der zeitlebens unter Roheiten und Demütigungen zu leiden gehabt hatte und schon als Kind dem gedankenlosen Spott seiner Schulkollegen ausgesetzt gewesen war, allmählich verbittert und heim tückisch geworden wäre. Aber er wird von seinen Bekannten als ein offenherziger, für jedes freundliche Wort dankbarer Mensch von echter Herzensgüte geschildert. Die Verarmung seiner Familie zwang ihn zu einem Broterwerb und nun wurde ihm seine Häßilichkeit das Mittel zum Lebensunterhalt. Eine Filmgesellschaft engagierte ihn für Clownrollen und kürzlich spielte er sich selbst in dem Film „Der rote Zwerg“, bei dem sich das Publikum vortrefflich unterhielt.
So lebte er ganz zufrieden und hatte sich mit seinem Los, überall Heiterkeit oder Abscheu zu erwecken, resigniert abgefunden – bis plötzlich dieser lächerliche Zwerg, der niemals Frauenzärtlichkeit gekannt hatte, von wilder Liebesleidenschaft erfaßt wurde. Er lernte die schöne Tänzerin Irene Favale kennen; sie machte sich über seine glühenden Schmeicheleien lustig und leistete sich den grausamen Spaß, mit ihm zu kokettieren. Er borgte sich bei Wucherern Geld aus und stürzte sich tief in Schulden, um seine Angebetete mit kostbaren Geschenken überhäufen, ihre kapriziösen Wünsche nach Toiletten und Schmuck erfüllen zu können. Als sie sah, daß er ihre anspruchsvollsten Launen befriedigte, wurde sie seine Geliebte und man sah das sonderbare Paar – sie überragte ihn um 60 Zentimeter – oft im Theater und in anderen Vergnügungsstätten. Er zitterte davor, die Geliebte zu verlieren, und ging die leichtsinnigsten Verpflichtungen ein. Als die Schuldner auf Bezahlung drängten und die Tänzerin, die seine Geldquelle versiegt sah, gegen den Unglücklichen, der nicht mehr aus noch ein wußte, immer kühler wurde, da richtete er den Revolver gegen seine Brust. Viele Neapolitanerinnen, die früher über den roten Zwerg immer gelacht hatten, beweinen jetzt sein trauriges Los.
Die Großmama des Burgtheaters
Erinnerungen an die Schauspielerin Amalie Haizinger, die im Jahr 1884 “die Augen für immer schloss”. Sie ließ das Mühlrad ihres Mundes klappern, ohne Rücksicht darauf, wem sie gegenüberstand.
Neue Freie Presse am 12. August 1924, Abendblatt
Eine der allerliebenswürdigsten und allermarkantesten Erscheinungen nicht allein auf der Bühne des alten Burgtheaters, sondern auf der deutschen Bühne überhaupt, ist Amalie Haizinger gewesen, die in der Blüte ihrer Jugend, in strahlender Schönheit nach Wien kam, um am 11. August 1884 nach nahezu vierzigjähriger Tätigkeit die Augen für immer zu schließen. Sie rückte allmählich zur Patriarchin des Burgtheaters auf, zur allverehrten Großmama der Künstlerfamilie auf dem Michaelerplatz. Gleich ihr machte ihre reizende Tochter Luise Neumann Aufsehen, die dem Burgtheater jedoch bloß ein Jahrzehnt angehörte, um die Bühne dauernd zu verlassen. Ihr Abschiedsabend gestaltete sich zu einem jener Familienfeste, wie sie das Publikum des alten Burgtheaters sich gern bereitete.
Mama Haizinger, die mit allen Fasern ihres Seins im Theater wurzelte, doch für Naturschönheiten keinen Sinn besaß (köstlich war ihre verdrossene Ablehnung der Aufforderung, sich von dem La Rocheschen Landhaus in Gmunden aus den Sonnenuntergang anzusehen: „I’ hab die Sonne erscht gestern bei Hebbel untergehe g‘sehe — ‚s ischt ja immer das Nämliche!“), vermochte es nicht zu fassen, wie man die Bühnenlaufbahn aufgeben könne. Daß sie, gleichwie ihr treuer Weggenosse La Roche, mit dem sie innige Freundschaft verband, unter den Augen Goethes gespielt, umgab sie mit einer Ausrede. Der Olympier soll herzlich gelacht haben, als die Haizinger ihm auf die Frage, was sie sich bei der Darstellung des Märchen eigentlich gedacht habe, treuherzig erwiderte: „Gar nichts hab‘ ich mir gedacht, als daß es ein Mädle ist, das einen zum Umkomme gern hat, und so hab‘ ich‘s g‘spielt.“
Als Heiligtum bewahrte sie auch ein Handbillet Goethes, das ihr, die sich nicht viel besann, bevor sie etwas ausführte, den weisen Rat erteilte: „Denken – und tun!“ In der Naivität ihres Humors war sie köstlich. Sie ließ das Mühlrad ihres Mundes klappern, ohne Rücksicht darauf, ob sie einem Höheren oder einem Niedrigen gegenüberstand. Einmal sollte ihr diese Unbesonnenheit übel bekommen. Es war im Jahre 1861, einige Wochen nach dem in Baden-Baden erfolgten Attentatsversuch auf Kaiser Wilhelm. Amalie Haizinger gastierte mit einem Ensemble des Burgtheaters im Berliner königlichen Schauspielhaus. Der überaus joviale alte Kaiser war von dem Zusammenspiel dermaßen entzückt, daß er sich im Zwischenakt auf die Bühne begab und zunächst die Haizinger ansprach. Sie verneigte sich tief und sagte, ohne zu bedenken, wie sie damit daneben griff: „Ne, Eure Majestät, wie wir alle derschrocke sind, wie wir die Unglücksgeschichte gehört habe, das kann ich Euer Majestät gar nit sage!“ Kaiser Wilhelm, über diese ebenso wohlgemeinte als des Taktes entbehrende, etikettewidrige Ansprache von Unwillen erfaßt, wandte sich rasch um und verließ die Bühne ….
Schweren Herzens entschloß sich Amalie Haizinger im Jahre 1876 – sie zählte damals allerdings bereits sechsundsiebzig Jahre – die Bühne zu verlassen. Allerdings nur als aktive Schauspielerin, denn bis zu ihrem acht Jahre später erfolgten Tod saß die „Großmama“ fast allabendlich in der Miniaturloge, welche ihr die Kollegen in der ersten Kulisse errichtet hatten. In den Zwischenakten plauderte sie in diesem kleinen, lieben „Austragsstüberl“ mit ihren Kollegen. Das Jahr 1884 sollte zugleich das Sterbejahr ihres getreuesten Partners Karl La Roche werden. Auch er hatte bereits einige Jahre vorher die Ausübung seiner Berufstätigkeit aufgegeben, und auch ihm hatten die Kollegen eine Art Triumphpforte auf dem Bühnenraum errichtet. Wie oft tauchten Großmama und Großpapa des alten Burgtheaters traulich herzliche Grüße von „Loge“ zu „Loge“! Amalie Haizinger und Karl La Roche bildeten ein wahrhaft ideales Paar.
Der falsche Bischof steht vor Gericht
Ist der Mann nun Arzt, Lehrer, Kardinal oder doch ein Prinz?
Neue Freie Presse am 11. August 1924
Aus München wird gemeldet: Ein falscher Bischof, der seine Wirksamkeit hauptsächlich in der Schweiz, in Tirol, davor in Deutschland ausübte, wo er schließlich gefaßt werden konnte, stand gestern vor dem Münchner Schöffengericht.
Es handelt sich um den 42jährigen ehemaligen Lehrer Josef Memmel aus Kronach in Oberfranken. Zunächst war er bloß Arzt und Universitätsprofessor aus München mit dem bescheidenen Namen Müller, der allerdings als Militärarzt im Kriege den deutschen Kronprinzen behandelt hatte und zum ehemaligen bayerischen Königshause in Beziehung stand. Mit dieser Folie wußte er einer Händlerin in der Schweiz, der er die Heirat versprach, 650 Goldfrancs herauszuschwindeln. Dann beförderte er sich zum Bischof, zum Kardinal bei der Ritenkongregation und schließlich zum bayerischen Prinzen aus der herzoglichen Linie.
Von diesen Würden wollte er allerdings aus bestimmten Gründen nicht öffentlich sprechen und auch seinen Namen nicht nennen. In Feldkirch (Vorarlberg) faßte ein Geistlicher solches Vertrauen zu ihm, daß er ihm vor einer Reise die Schlüssel seines Hauses übergab. Während dieser Zeit las Memmel in der Hauskapelle wie ein Bischof die Messe.
Als der Geistliche zurückkam, war aber der Amtsbruder verschwunden und mit ihm nicht nur 500 Francs, sondern auch die Weihezeugnisse des Geistlichen und andere Urkunden. Nach weiteren geistlichen Gastrollen in Zürich, Romanshorn und Weingarten (Württemberg) erschien Memmel September 1923 in München, w er gleichfalls als Priester Messen las und andere geistliche Handlungen gegen Bezahlung vornahm. Durch Bettelbriefe nach dem Ausland, in denen er um „Spenden für arme Geistliche“ bat, erhielt er namhafte Beträge. Schließlich kam der Schwindel auf.
Bei der Verhandlung erschien nun Memmel in schwarzer Priesterkleidung und mit Tonsur. Wie er angab, hatte er von Jugend auf Neigung zum Priesterstand: er war sieben Jahre lang Ministrant und nahm als Seminarist lateinischen Unterricht. Nach seiner Pensionierung als Lehrer wollte er Jesuitenfrater werden. Er beteuerte, daß er ein streng religiöser Mann sei und seine Schwindeleien nur aus Not begangen habe. Von Zeugen wurde bekundet, daß sich Memmel das Vertrauen der Leute durch seine einfache und bescheidene Lebensweise erworben habe und gegen Bedürftige sehr wohltätig gewesen sei.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Betruges, Urkundenfälschung, Diebstahls und fortgesetzten Vergehens wider die Religion zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis.
Sträflinge im Seebad
Normalerweise sitzen sie in einem Londoner Gefängnis, nun dürfen 40 Häftlinge Sonne, Strand und Meer genießen.
Neue Freie Presse am 10. August 1924
Die Insel Wight beherbergt augenblicklich sonderbare Badegäste. Vierzig Sträflinge aus dem Londoner Maidstonegefängnis weilen auf ihr zur Sommerfrische. Nicht etwa in einem dort improvisierten Zuchthaus, sondern in einem allerdings abgelegenen Hotel; sie können frei über ihren Tag verfügen, Sonne, Sand und Meer wurde ihnen von der Verwaltung der Strafanstalt zur beliebigen Benutzung anvertraut, sie hatten nur ihr Ehrenwort abzugeben, keinen Fluchtversuch zu unternehmen, der auf der einsamen Insel ohnehin vergeblich bleiben müßte.
Die Vierzig sind durchaus nicht etwa leichte Fälle, sondern sie wurden ausschließlich aus Zuchthäuslern ausgewählt, die mehrjährige Strafen zu verbüßen haben; nur Mörder und offenbar Gewalttätige erhielten keinen Urlaub. Der Versuch scheint kühn, und es fehlt in England nicht an Leuten, die ihn verurteilen und besonders über das Ehrenwort der Sträflinge unwillig die strengen Köpfe schütteln. Aber wahrscheinlich haben doch jene recht, die sich von dem Unternehmen eine heilsame Wirkung versprechen.
Die Geste des Vertrauens wird, so erwarten sie, stärkend auf diese Ausgestoßenen wirken, der Ausflug in die Freiheit die Zuchthauspsychose verdrängen. Ein solcher Heilerfolg von drei Wochen Badekur, das heißt viel hoffen, aber die Umwälzung in allen Lebensgewohnheiten mag die Vierzig wohl stark durchrütteln. Eben nur graue Mauern um sich, Härte und Befehl, zur Nummer degradiert, und nun plötzlich eine andere Welt, an Stelle der Zelle. Der Seebadausflug wurde natürlich als Belohnung für jene Sträflinge vorbehalten, deren Führung im Zuchthaus am besten war.
Der Wiener Bäderzug und das Fräulein Bubikopf
Der Wiener Bäderzug ist nicht so vornehm wie die Bäderzüge anderer Großstädte. Er repräsentiert eine Garnitur humpeliger Waggons, die keinerlei Anspruch auf Eleganz machen.
Neue Freie Presse am 9. August 1924
Der Wiener Bäderzug ist nicht so vornehm wie die Bäderzüge anderer Großstädte. Er fährt nicht an die Ostsee, an keine exklusive Seaside, an keine hypermoderne, hyperschicke Plage. Er besteht nicht aus weichgepolsterten Pullman-Waggons und vergeblich würde man an seiner Front die verlockende Aufschrift „Dining Car“ suchen. Nein, der Wiener Bäderzug repräsentiert eine Garnitur humpeliger Waggons, die keinerlei Anspruch auf Eleganz machen und auch seine Schnelligkeit ist nicht übertrieben, denn er fährt ja bloß nach Kahlenbergerdorf, Klosterneuburg, Kritzendorf und Greifenstein. Und trotzdem führt er Passagiere, die es an Schönheit, Schick, Temperament und Lebenslust getrost mit den mondainen und mehr noch mit den mondain sein wollenden Damen aufnehmen können, die, in weiche Kissen geschmiegt, ein wenig blasiert und gelangweilt, den Raffinements von Deauville entgegenfahren.
Es ist das Wiener Mädel, das diesen Zug bevölkert, und an Samstagen und Sonntage sogar übervölkert, und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Rasse und Sanftmut, Keckheit und Sentimentalität sind in diesem Wiener Mädel in glücklichster Weise vereinigt und überstehen alle seine von der Mode diktierten Wandlungen. Momentan heißt das Wiener Mädel: Fräulein Bubikopf. Ob blond oder schwarz, ob tizianrot oder brünett, die Haare sind im Nacken kurz geschnitten und umrahmen wuschelig das kapriziöse Köpfchen. Wenn Fräulein Bubikopf im Dirndlgewand, die Aktentasche unterm Arm, die Stufen zum Franz Josefsbahnhof emporschreitet, hat sie natürlich den Hut zu Hause gelassen. Wozu auch einen Hut?
Sie liebt es, mitten in der Großstadt Sommerfrische zu spielen, und auf dem Althanplatz wimmelt es vor Abgang der Lokalzüge so farbenbunt wie auf irgendeiner beliebigen Esplanade im Salzkammergut. Der Dirndlrock schimmert in allen Farben des Regenbogens, die koketten Stutzerln, die über die Haferlschuhe hinauslugen, ebenfalls und nur die seriöse Aktentasche erinnert daran, daß man eigentlich nicht aus dem „Weißen Rössel“ oder dem Esplanadehotel kommt, sondern aus dem D-Wagen ausgestiegen ist. In der Aktentasche sind nämlich das Badetrikot, die Badehaube, die Schinkensemmel und die Pralinees verstaut. Es ist das ganze Gepäck, das Fräulein Bubikopf für ihren Tag in Kritzendorf mitnimmt, leicht genug, so leicht wie ihr Herz und ihr Sinn. Denn sie macht nicht viel Umstände, sie fährt unbekümmert dritter Klasse, die Hauptsache ist ihr der Tag in Sonne, Luft und Wasser. Den kostet sie allerdings bis zur Neige aus. Ergibt sich noch ein kleiner Flirt dazu, dann ist das Glück vollkommen und hat seinen Höhepunkt erreicht. Denn Sonne, Luft und Wasser sind viel angenehmer, wenn jemand da ist, der einem sagt, daß man entzückend aussieht.
Abends führt der Bäderzug alle die lieben Bademädchen wieder heim, an den häuslichen Herd, unter die friedliche Familienlampe. Mama erwartet sie ohne Bangen. Sie weiß, daß Fräulein Bubikopf selbständig ist und daß man sich auf sie verlassen darf. Man kann sie ruhig einen schönen Sommertag in vollen Zügen genießen lassen. Daß sie dies tut, beweisen die vollen Züge der Franz Josefsbahn.
Eine Erfindung auf dem Gebiete der plastischen Kosmetik
Ein Doktor hat ein Präparat gefunden, durch das Falten, Augenrunzeln, Gesichtsatrophien, Nasen- und Dekolletédefekte, zu scharfe Züge und Narbenentstellungen dauernd beseitigt werden können.
Neue Freie Presse am 8. August 1924
Die größte Sehnsucht jeder alternden und gealterten Frau gilt der Jugend, die sie verloren glaubt, während das Mädchen mit allen Mitteln versucht, gerade in unserem schnellebigen Jahrhundert die Blütezeit seines Lebens festzuhalten. Mit Recht! Denn gerade bei der Frau steht mit dem äußeren Aussehen die innere Zufriedenheit im nächsten Zusammenhang. Die ersten Fältchen und Runzeln, die ihr der Spiegel zeigt, rauben ihr die Ruhe und das für eine Frau von Welt absolut notwendige Selbstvertrauen; denn Hand in Hand mit der Sorge um ihre Schönheit geht die Angst um ihr Glück. Sie wird nervös, deprimiert, sieht in der schlechten Laune ihres Mannes nicht vielleicht irgendeinen Mißerfolg im Berufe oder im Geschäfte, sondern fürchtet, daß auch er gesehen, was ihr eben der Spiegel gesagt.
Das Leben selbst verlangt bei vielen das gefällige Aussehen! Wie viele Mädchen kommen eines kleineren oder größeren Schönheitsfehlers wegen nicht zur Ehe, wie viele begabte Schauspieler oder Musiker scheitern im Leben durch einen kosmetischen Defekt, der ihre oft gute Begabung wertlos macht! Nun soll endlich das Mittel gefunden sein, das alle jene Defekte restlos zu beseitigen imstande ist. Keine Falte ist tief genug, keine Nase so häßlich, kein Dekolleté so unschön, daß sie nicht, wie alle Schönheitsfehler, dauernd sicher behoben werden können.
Der deutsche Arzt Doktor Fritz Pulfer, der seit fünf Jahren sein Mittel im Auslande mit bestem Erfolge und mit Anerkennung von seiten vieler Aerzte erprobt hat, arbeitet derzeit gemeinsam mit Wiener Aerzten. In Wiener ärztlichen Kreisen ist folgendes über sein neues Mittel, das „Plastin“, bekannt. Dr. Pulfer hat ein vollständig paraffinfreies Präparat gefunden, durch das Falten, Augenrunzeln, Gesichtsatrophien, Nasen- und Dekolletédefekte, zu scharfe Züge, Narbenentstellungen usw. dauernd beseitigt werden können. Dieses Präparat ist von dünnflüssiger Konsistenz, wird unter die Haut injiziert und ersetzt verloren gegangenes Gewebe. Es wirkt nicht mechanisch, das heißt nur ausfüllend, sondern wird im Körper resorbiert und assimiliert; das neue Gewebe hat normale Konsistenz, fügt sich als arteigener Bestandteil dem Organismus ein und hat normale Funktion. Verhärtungen und Senkungen sind von vornherein ausgeschaltet.
Wie mitgeteilt wird, hat sich der Zentralverband der österreichischen Invalidenivereinigungen mit Herrn Dr. Pulfer bereits in Verbindung gesetzt, um den Kriegsverletzten und Narbenverstümmelten diese Hilfe zu sichern, die ihnen von dem Erfinder des Präparates in entgegenkommender Weise zugesagt wurde. Keine Angst mehr vor dem Alter, sondern nur mehr Schönheit und Jugend – das ist ein schöner Traum für jedermann.
Der Flieger im Haus
Der Unfall, der sich in einem kleinen hübschen Städtchen bei Paris ereignete, zeigt eine einprägsame und symbolische Tragik.
Neue Freie Presse am 7. August 1924
Man schreibt uns aus Paris: Der Unfall, der sich in Bourg-la-Reine, dem kleinen hübschen Städtchen bei Paris, kürzlich ereignete, zeigt eine einprägsame und symbolische Tragik. In den letzten Abenden kreuzte dort stets ein Militärflugzeug, und die Einwohner von Bourg-la-Reine betrachteten diesen Avion wie ein schwebendes Teil ihrer Stadt, saß darin doch als Pilot der junge Rapin, ein Kind von Bourg-la-Reine, der ihnen seinen Besuch pünktlich abzustatten pflegte, wohl, um sich als Luftkünstler von ihnen bewundern zu lassen. Vielleicht wollte er auch besonders sich seiner alten Mutter zeigen, die in der Grand Rue 90 ihre Färberei hat und trotz ihrer siebzig Jahre altfranzösisch arbeitsam, unermüdlich im Geschäft steht.
Nur wenn sie das Knattern des Motors hört, kommt sie wohl heraus und späht stolz lächelnd hinauf und winkt ihrem Jungen zu, und die ganze kleine Welt herum, die Nachbarn und braven Bourgeois, nicken ihr anerkennend zu und lächeln. Der junge Rapin macht in der Luft stets die artigsten Kunststücke mit seinem Aeroplan, dreht sich und überschlägt sich, ein wahrer Teufelskerl, und damit er wohl gesehen werden kann und auch selbst alle seine Bekannten zu erkennen vermag, schraubt er sich immer ganz tief herunter, daß man manchmal leicht beängstigt fast meint, er könne mit seinen Händen die Dächer berühren.
Wie gesagt, es ist schon nichts Besonderes mehr, doch immerhin, es gibt außer der Mutter Rapin noch einige Frauen, welche ihre Einkäufe für das Abendessen und den Haushalt besorgt haben und gerade noch friedlich etwas schwatzen. Aber diesmal kommt der junge Rapin doch gar zu nahe mit seinem Besuch, und ehe die Menschen auch nur Zeit haben, einen Entsetzensschrei auszustoßen, wirbelt das Flugzeug herunter, gerade auf die mütterlicher Färberei und auf die alte Frau, die gar nicht wie die anderen auch nur versucht zur Seite zu springen und sich zu retten, wo doch ihr Sohn drinnen sitzt. Mit gebrochenem Schädel wird sie ins Spital geschleppt und die andere alte Frau liegt tot da mit ihrem Einkaufskorb und den guten, voreilig gekauften Dingen für ihr Abendessen, und der Mechaniker ist vom Motor zerquetscht.
Es gibt noch andere Verwundete in der Grande Rue der kleinen Stadt, nur dem jungen Rapin ist nicht viel geschehen. Die schon so zahlreiche Chronik der aviatischen Unglücksfälle hat gewiß einen solchen Fall noch nicht verzeichnet, daß der Pilot gerade am eigenen Hause zerschellt und seine Mutter zerschmettert, während sie und er sich glücklich grüßen. In der Presse gibt es erregte Betrachtungen über den Unfug dieser gefährlichen Luftproduktionen, der in Frankreich umso mehr überhandnahm, da er Gelegenheit gibt, Mut zu zeigen und Eitelkeit zu befriedigen, also zwei Grundlementen des französischen Wesens entspricht. Die sommerliche Kammer wurde durch eine Interpellation des Deputierten Girod etwas aufgemuntert, der eine Untersuchung und eine Bestrafung jener Beamten fordert, die nicht gegen diese Luftakrobatik rechtzeitig einschritten. All dies ist richtig und vernünftig, und vielleicht werden nunmehr die ausgezeichneten papierenen Verordnungen befolgt werden. Aber das ändert nichts an dem seltsamen Abenteuer des Fliegers der geradewegs ins Geschäft seiner Mutter abstürzt und sie tötet, während sie ihm mit stolz verklärtem Lächeln zuwinkt.
Einkaufsreise der Mrs. Rockefeller nach Wien
Die Gattin des amerikanischen Petroleumkönigs, des reichsten Mannes der Welt, weilte einige Tage inkognito in Wien.
Neue Freie Presse am 6. August 1924
Mrs. John D. Rockefeller aus Detroit, Michigan, die Gattin des amerikanischen Petroleumkönigs, des reichsten Mannes der Welt, weilte einige Tage, begleitet von Tochter und Schwägerin, inkognito in Wien. In ihrer Gesellschaft befand sich auch Dr. W. R. Balentiner, einer der bedeutendsten Kunsthistoriker Amerikas. der früher am Metropolitan Museum in Newyort tätig war und jetzt das Museum in Detroit leitet, das seine Entstehung der Munisizenz Rockefellers verdankt.
Der hiesige Aufenthalt Mrs. Rockefellers war sehr kurz bemessen und galt nur der Besichtigung der Museen und einem Besuch des Hauses Hermann Frankl, 1. Bezirk, Kohlmarkt 4, von dessen antiken Teppichen und Gobelins gefunden haben.
Nach längerem Verweilen in der öffentlichen Bibliothek dieses Hauses und in der musealen Abteilung tätigte Mrs. Rockefeller einen größeren Einkauf in antiken persischen Samten und Teppichen für das Museum in Detroit und lud den Inhaber ein, sie auf seiner diesjährigen Amerikareise in Detroit aufzusuchen, da sie gedenke, noch einige hier besichtigte interessante Stücke auf Anraten ihres Museumdirektors an Ort und Stelle zu erwerben.
Auf der Eisscholle durch die Arktis
Die Besatzung des dänischen Expeditionsschiffes “Teddy” hat eine abenteuerliche Reise hinter sich.
Neue Freie Presse am 5. August 1924
Die Kopenhagener „Politiken“ erhält aus Reykjavik die Nachricht, daß die 21 Mann zählende Besatzung des dänischen Expeditionsschiffes „Teddy“ auf dem norwegischen Seehundefängerschiff „Quest“ (dem berühmten Schiff Shakletons) in Reykjavik eingetroffen ist. Die Besatzung hat eine abenteuerliche Reise hinter sich.
Am 1. August im vorigen Jahre gelangte die „Teddy“ nach Germaniahavn, der nördlichsten Station der Ostgrönländischen Kompagnie an der Ostküste Grönlands. Hier, 500 Kilometer von Scoresby Sund, geschah das Unglück, das „Teddys“ Schicksal besiegelte, indem das Schiff, nachdem es Germaniahavn verlassen hatte, 60 Kilometer von der Küste entfernt, gegen eine Eisbarriere fuhr, die sich als undurchdringlich erwies. Schwere Stürme und Eisschraubungen trieben das Schiff immer dichter in das Treibeis hinein und bedrohten das Schiff auf offenem Meer.
Am 9. August wurde die Maschine gebrauchsunfähig und das Schiff verlor jede Fähigkeit zu manövrieren. Am 21. August war es ganz von Treibeis eingesperrt und so havariert, daß keine Hoffnung mehr bestand, es zu retten. Das Ruder war gänzlich zerstört und das Schiff hatte ein großes Leck. „Teddy“ lag so fest im Eis, daß man beschloß, ein Haus in seiner Nähe auf dem Eise zu bauen. Den ganzen September trieben die Eismassen mit dem Schiff und dem so gut wie möglich gezimmerten Haus südwärts und gerieten in die Nähe von Scoresby Sund, allerdings in einer Entfernung von mehr als 100 Kilometer von der Küste. Anfang Oktober wurde die Lage so kritisch, daß man den Untergang des Schiffes befürchten mußte.
Der Kapitän Bistrup beschloß darum, das Schiff seinem Schicksal zu überlassen und zu versuchen, auf einer Eisscholle Land zu erreichen. Die Besatzung begab sich auf eine Eisscholle, auf der sie vier Wochen südwärts trieb, in steter Gefahr, von Eisbergen und Stürmen zerschmettert zu werden. Am 5. November, nachdem die Scholle durch Zusammenstöße mit Eisbergen immer kleiner geworden war und alles in allem eine Strecke von mehr als 400 Kilometer zurückgelegt hatte, gelang es der Mannschaft, auf einer kleinen Insel, die 50 Kilometer von der Kolonie Angmagsalik im Meer liegt, zu landen. Hier wurden die Schiffbrüchigen, die furchtbar unter Skorbut zu leiden gehabt hatten, von Eskimos entdeckt, die ihnen den Weg über das Eis zur Küste wiesen. Am 14. Dezember betraten die 21 Männer endlich festes Land bei Angmagsalik, von wo aus sie, wie gesagt, auf der „Quest“ nach Reykjavik befördert wurden.
Eine 20-Jährige herrscht in der „grünen Hölle“
Ein französisches Forscherteam und eine Studentin wagten sich nach Südamerika – und erleben dort seither Abenteuerliches.
Neue Freie Presse am 4. August 1934
Die „grüne Hölle“ Südamerikas, jenes weite Dschungel- und Steppengebiet, in das bisher nur wenige Weiße ihren Fuß gesetzt haben, hat schon viele Expeditionen verschlungen und nicht wieder herausgegeben. Von den Indianerstämmen, die in diesem Landstrich wohnen, weiß man so gut wie gar nichts. Händler, die manchmal mit indianischen Reitern in Berührung gekommen sind, erzählten jedoch Wunderdinge von den Prunkbauten, die sich mitten im Dschungel erheben, und von der hohen Kulturstufe, auf der manche dieser Stämme leben sollen. Ein französischer Missionär, der in diesen Tagen aus Südamerika zurückgekehrt ist, nachdem er fast sieben Jahre lang bei einem Indianerstamm im Inneren der „grünen Hölle“ gefangen gehalten worden ist, erzählt nun in französischen Blättern die sonderbare Geschichte einer jungen Pariserin, der er in der Hauptsiedlung der Pepekuanos, eines hochstehenden, großen Indianervolkes, begegnet ist.
Arlette Barrus, die zwanzigjährige Pariserin, ist Studentin an der Sorbonne. Sie schloß sich vor zwei Jahren einer kleinen, privaten Expedition an, die von dem französischen Industriellen Huguenau finanziert worden ist und die mit der Absicht, unbekannte Volksstämme zu entdecken, unter der Führung des Professors Delogus in die „grüne Hölle“ vordrang. Die Expedition ist verschollen. Trotzdem wurden die Expeditionsteilnehmer nicht aufgegeben.
Der Missionär hat nun in der Indianersiedlung Arlette Barrus gefunden und mit ihr gesprochen. Ihr verdankt er seine Befreiung aus der Gefangenschaft. Die junge Studentin erzählte dem Missionär ihre abenteuerliche Geschichte: Nach dreimonatigem, unter furchtbaren Entbehrungen und Qualen durchgeführten Marsch in das Innere des Landes erkrankte ein Mitglied der Expedition nach dem anderen an einer rätselhaften Krankheit. Mühselig schleppten sie sich weiter.
Eines Tages wurden sie von Indianern gefangen genommen. Man pflegte sie, betrachtete sie verwundert, selten wohl mochten die Rothäute Menschen mit weißen Gesichtern gesehen haben. Man brachte die vier Forscher vor den Stammeshäuptling. Eine Verständigung war nicht möglich, aber die Forscher merkten bald, daß ihnen die Indianer nichts zu leide tun würden. Sie wurden bewirtet und gesund gepflegt, aber sie durften sich nicht aus dem Lager entfernen. Nach einigen Wochen der mildesten Gefangenschaft merkte Arlette, daß der Häuptling des Stammes Interesse an ihr fand, und eines Tages macht er ihr, wie sie aus seinen Gesten verstand, einen Heiratsantrag.
Es ist schwer nachzufühlen, was in der jungen Französin vorging, als sie den Antrag annahm. Wahrscheinlich wußte sie, daß sie damit ihre Gefährten retten konnte. Jedenfalls wurde die Heirat nach dem indianischen Zeremoniell durchgeführt. Der Klugheit der in den Busch verschlagenen Studentin und ihrer Ratgeber, der französischen Forscher, die so etwas wie „Ministerstellen“ erhielten, gelang es, große Indianerstämme zu einem Reich zusammenzufassen, über die Arlette Barrus ziemlich unumschränkt herrscht. Sie hat, so berichtet der Missionär, schon sehr wichtiges Forschungsmaterial gesammelt und hofft in absehbarer Zeit damit nach Europa zurückkehren zu können. Ob für endgültig oder nur für einen kurzen Besuch, darüber weiß sie selbst noch nichts auszusagen.
Adolf Hitler ist Staatsoberhaupt
Alle Machtmittel im Deutschen Reich sind nun einem einzigen Mann untergeordnet.
Neue Freie Presse am 3. August 1934
Das Deutsche Reich hat in Adolf Hitler sein neues Staatsoberhaupt erhalten. Das Amt des Reichspräsidenten wurde mit den Funktionen des Reichskanzlers vereinigt und so eine Machtfülle geschaffen, wie sie in unseren Tagen kaum einem anderen Staatslenker zuteil wird.
Der in der Aera Schleicher vorgesehene Uebergang, die Einschiebung eines Zwischenstadiums durch die vorübergehende Betrauung des Reichsgerichtspräsidenten mit der obersten Würde im Staate, ist nicht in Frage gekommen, weil die gegenwärtige Regierung die Rechtsbasis durch einen Gesetzesbeschluß unmittelbar vor dem Ableben des greisen Generalfeldmarschalls veränderte. Adolf Hitler übernimmt das Erbe seines Vorgängers in einem kritischen Augenblick, und überaus wichtige Entscheidungen werden in nächster Zeit zu treffen sein. Ihm fällt nun die ganze Gewalt im Reiche zu.
Bisher war Adolf Hitler Führer und höchster Parteifunktionär. Jetzt aber soll er alleiniger Repräsentant eines der größten Reiche sein und eine Würde bekleiden, die nach der in aller Welt geltenden Auffassung ihren Träger über den Streit der Meinungen und der Gruppen erheben sollte. Adolf Hitler, Reichspräsident und Reichskanzler zugleich, vereinigt alle Befugnisse in seinen Händen, sein Wille besitzt unter den gegebenen Verhältnissen ausschlaggebende Kraft; nichts vermag ohne seine Zustimmung zu geschehen. Er steht an der Spitze der Regierung, deren Zusammensetzung ihm einzig und allein obliegt, er leitet die innere und äußere Politik und schreibt der Verwaltung ihren Gang vor. Die Reichswehr ist bereits auf seine Person vereidigt, und damit sind ihm alle Machtmittel restlos untergeordnet
Der Knüppelkunze und seine Rettung
Dafür, dass er noch am Leben ist, gab es keinen Dank.
Neue Freie Presse am 2. August 1924
Aus Berlin wird uns gemeldet: Der antisemitische Agitator Knüppelkunze wurde, wie berichtet, vor einigen Tagen, als er in Leba ein Seebad nahm, durch den dortigen Badearzt Doktor Posner vor dem Tode des Ertrinkens gerettet. Dr. Posner übersendet nun dem „Berliner Tageblatt“ einen Brief, in dem er den Vorfall folgendermaßen schildert:
Kunze badete an einem Tage, an dem ein sehr schwerer Nordweststurm herrschte. Die Strömung war rasend, aber Kunze fand sie arglos und ging ins Wasser, so daß ich sofort u meiner Frau sagte, der wird abgetrieben. Ich hatte es noch nicht ganz ausgesprochen, da hing er schon an dem Drahtseil, das die Badeanstalt umschließt. An diesem hätte er sich ohne weiteres anhalten können, wenn er nicht völlig den Kopf verloren hätte. Er blieb an dem Seil hängen, rief: „Holt mich doch!“ Und verlor seine Badehose. Das ist der ganze Sachverhalt.
Ich habe ihn dann noch in ein Badetuch gewickelt, damit er sich vor den Menschen nicht unverhüllt zu zeigen brauchte. Schließlich ist noch zu berichten, daß Kunze es für nicht der Mühe wert hielt, sich zu bedanken (er hat sich aber später, als er wieder der große Kunze war, erkundigt, ob ich Jude sei).Ich kann ihn demnach soweit entlasten, daß ich der Ansicht bin, daß die Sache nicht des Dankes wert war und ich gebe ihm die Versicherung, daß ich auch weiterhin jedem in Not beispringen werde, daß ich aber niemals dulden wer e, daß sich ein Knüppelkunze bei mir bedankt.
Anmerkung: Richard Kunze, bekannt auch als Knüppel-Kunze, wurde am 5. Februar 1872 in Sagan, in der damaligen Provinz Schlesien geboren und starb im Mai 1945. Er war ein deutscher Lehrer, Publizist und völkisch-nationalsozialistischer Politiker.
Die Verbrechen des Weltkrieges
Hans Delbrück, Professor der Geschichte an der Universität in Berlin, stellt die Frage: Wer sind die Schuldigen?
Neue Freie Presse am 1. August 1924
Ich bin immer ein Freund des alten Oesterreich gewesen. Ich weiß sehr wohl, an welchen Mängeln dieses Staatswesen litt und wie wenig seine Bewohner von ihrem politischen Zustand befriedigt waren. Aber da der Lauf der Weltgeschichte einmal an der mittleren Donau die zehn Nationalitäten so durcheinander geschüttelt hat, so ist ein gefahr- und reibungsloser Zustand im Zeitalter der Nationalitätenkämpfe überhaupt nicht zu erreichen, und der habsburgische Staat, wenn er sich im Sinne des ermordeten Franz Ferdinand weiter entwickelt hätte, würde mir immer noch als die praktisch beste Lösung dieses ideell unlösbaren Problems erschienen sein.
Wir trösten uns des schweren Schicksals, das über uns verhängt worden ist, mit der sicheren Aussicht, daß der Schlußerfolg früher oder später die Vereinigung der Reichsdeutschen mit ihren österreichischen Stammesbrüdern sein wird. Aber wenn wir den heutigen Zustand des ehedem so stolzen deutschen Volkes betraten, so können wir doch auf den Ursprung unserer Leiden immer nur zurückblicken mit der Frage, wer war der Schuldige?
Wessen Tun ist es gewesen, der dieses Leiden über unser Volk und zugleich über die Menschheit gebracht hat? Diese Frage muß ganz ebenso an der Spree wie an er Donau immer von neuem gestellt werden.
Man pflegt dafür die Formel zu gebrauchen, daß Deutschland und Oesterreich nicht mit der Alleinschuld für den Ausbruch des Krieges belastet werden dürften. Diese Formel genügt nicht. Das Versailler Ultimatum und die öffentliche Meinung der uns feindlichen Welt beschuldigt Deutschland, den Weltkrieg mit Absicht und Vorbedacht vorbereitet und entfesselt zu haben.
Dieser Anklage gegenüber dürfen und müssen wir behaupten, daß wir nicht nur nicht allein schuldig, sondern schlechthin unschuldig sind, daß an dieser Anklage kein wahres Wort ist, daß unsere Politik zwar, wie es in der Natur der Dinge liegt, auch gewisse Fehler gemacht hat, daß aber zwischen solchen Fehlern, mag man sie größer oder kleiner einschätzen, und der verbrecherischen Absicht vorsätzlicher Herbeiführung des Weltkrieges ein himmelweiter Unterschied entsteht und daß schließlich die verbrecherische Absicht nicht bei uns, sondern bei unseren Gegnern war.

Post a Comment